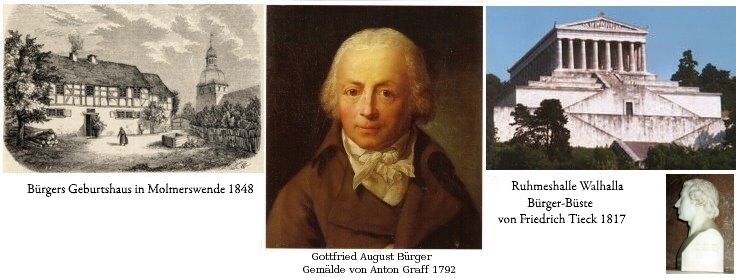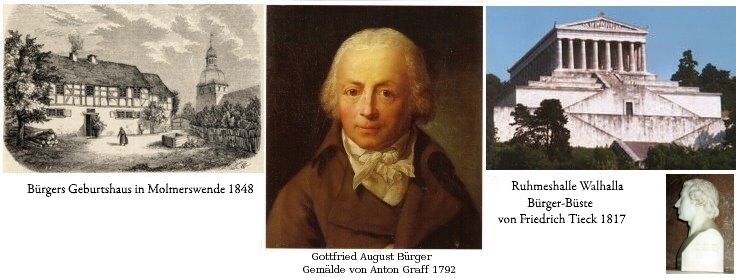|
|
Bürger-Rezeption Volltexte 1837-1840
bis 1789 1790-1799 1800-1806 1807-1815 1816-1821 1822-1825 1826-1828 1829-1831
1832-1836 1837-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1858 1859-1861 1862-1865
1866-1868 1869-1870 1871-1880 1881-1897 1898-1915 1916-1949 ab 1950
|
|
1837
|
Köchly, Hermann August Theodor. 2.Scene. In: Ueber die Vögel des Aristophanes
“[S. 16] Die Götterbotin Iris kommt herbeigeflattert; sie wird gestellt, verhaftet, verhört, und muss bekennen, dass Zeus sie zu den Menschen geschickt hat diese zu Opfern aufzufordern, da die Götter richtig schon Mangel leiden. Sie erfährt zu ihrem Erstaunen und Schrecken, dass die Vögel jetzt die Götter der Menschen sind, dass ihnen und nicht dem Zeus geopfert wird. Wie es bei der Aussicht auf Krieg stets üblich zu sein pflegt, so nimmt auch Peithethäros den Mund etwas voll: dass die guten Götter, wenn sie sich willig unterwerfen, doch einige Opfersporteln retten sollen, davon ist hier noch nicht die Rede. Mit Drohungen der ärgsten Art wird die Erschreckte entlassen und der Chor verkündet die vollendete Thatsache des gegen die Götter verhängten <<blocus hermétique>>.
Man hat auch diese Scene gemissbraucht, unsern <<alten Knaben>> zu einem Bruder Lüderlich zu stempeln. Es wird wohl nicht ferner nöthig sein ihn deshalb zu
vertheidigen, dass er der kecken Spionin die Strafe androht, welche Bürger's Veit Ehrenwort an seiner hübschen Gartendiebin vollzieht.“
|
|
1837
|
Ruge, Arnold. Die Burleske. In: Neue Vorschule der Aesthetik. Digitalisiert von Google.
“[S. 195] Die Burleske findet das Geringste nicht zu geringe, und das Gemeinste nicht zu gemein, um in seiner Particularität das Allgemeine zu zeigen, im Gegentheil es steigert sich
hier noch die Heiterkeit und wird lustige Ausgelassenheit, darum weil der überwundene Gegensatz so viel greller war, und deshalb um so viel stärkere Bewegung hervorrief. Es ist daher auch kein geringer Mangel
an Bildung, wenn die Burleske als reine Gemeinheit zurückgewiesen und der dezente wollüstige Ausdruck in Schutz genommen wird. Eine alte Gestalt nur noch, die freilich auch ihres Gleichen sucht, hat den Kopf über
dem Wasser, trotz aller Lüderlichkeit und Nichtswürdigkeit, die in ihr zu Tage liegen, das ist Falstaf, der darum auch ein Anker sein wird, an dem der gute Geschmack sich seine alte Derbheit und Maskenfreiheit
rettet. Wenn dieser Mann ganzlich entblößt vor uns dasteht, und es nun scheint, als müßten wir uns unwillig für immer von ihm abwenden, so hält er seinen Monolog über die Ehre und zeigt, daß man sie
nicht essen
kann, daß sie ein Wind und ein Schall ist, und so behauptet er nur desto glänzender seine komische Ehre, indem er seine ritterliche auszieht. Die Burleske ist dieser Falstafs-Monolog, dessen Unehre eben zur Ehre
wird, denn sie ist flüssig in diesem Prozeß der Idealität, worin sie ihre Unwahrheit selbst offenbart, und so zu ihrer Wahrheit kommt. Die Burleske ist diese Subjectivität der Empfindung, deren Laune und
Ausgelassenheit eben darin besteht, daß sie sich so auf das Niedrige einläßt. Sie ist und bleibt daher Lyrik, ist immer diese Empfindung und subjective Heiterkeit, die freilich wohl nicht ohne ihre
Gegenständlichkeit ist, dieselbe aber vollständig in sich übersetzt hat. So Bürger's Gedicht vom Zeus und der Europa, von der Frau Schnipsen und andere, welche darum, weil sie erzählen, nicht reinepisch sind, diese Dinge gehen in dieser Heiterkeit vor, und sie sind nichts als eben diese Erscheinung der burlesken Laune. Auch Blumauer ist glücklich und berühmt in diesem Genre, und führt zugleich auf die Form der Burleske, welche sie als Travestie hat, über. Jean Paul rechnet diese ebenfalls, trotz des epischen Scheins, zur Burleske, und mit Recht. Sie setzt das Niedrige an die Stelle des Erhabenen, so daß auch die Stelle und die Aeußerlichkeit die Entgegengesetzten vereinigt, die Substanz der Travestie ist aber wiederum diese Heiterkeit der Empfindung, die burleske Laune, deren eigne ihr angemessene poetische Form die Knittelverse sind, als niedrigste Form.”
|
|
1837
|
Wagner, J. J. Die Poesie als wahrhaft freie Kunst in Theorie und Exempeln. In: Isis von Oken, Leipzig Heft XI. Digitalisiert von Google
“[Sp. 820] Die getrennten Wege der didactischen und musikalischen Poesie, beide vom Epigramme ausgehend, laufen nun in der Romanze als einer lyrisch aufgefaßten Lebensscene zusammen,
indem hier ebensowohl Ansichten als Gefühle ihre Stelle finden können. Goethes Veilchen, Heidenröschen, Fischer, Braut von Korinth, König in Thule u. a. sind herrliche Beyspiele davon, und Bürgers Lenore mit ihrer Herrlichkeit überstrahlt noch seine Pfarrers Tochter und andere seiner Romanzen. Ueberall verlangt die Romanze eine lebendige Handlung, sey sie auch noch so einfach, wie das Zertreten eines Veilchens, das Pflücken einer Rose und dergl., und deutet damit auf die höheren Formen der Poesie des Romans, des Dramas und des Epos hinüber. Um auch von der Romanze ein Beyspiel zu geben, das sich an meine oben gegebenen Beyspiele der andern Dichtungsarten anschließt, will ich den Jammer des Gefangenen in die Form eines Spottliedes aufgenommen als Romanze darstellen, wobey übrigens die Berührung mit Bürgers Raubgraf ganz zufällig ist.“
|
|
1837
|
Harnisch, Wilhelm. Woher entsteht die vorsätzliche Tödtung? In: Entwürfe und Stoffe zu Unterredungen über die zehn Gebote. Zweite Auflage. Digitalisiert von Google.
“[S. 314] Bemerk. Wer das fünfte Gebot mit Erwachsenen behandelt, der hat hier Gelegenheit, vielfach darauf aufmerksam zu machen, wie so viele Vergiftungen und andre Tödtungen aus
unkeuschen Lüsten und Begierden, aus unbesonnenen Heirathen, und überhaupt aus dem Geschlechtstrieb hervorgehen. Einen scheußlichen Belag dazu liefert die schreckliche Bremische Gifttödterin Gesche Gottfried, deren
Leben Voget beschrieben hat. Der Kindermord an ungebornen, sowie an neugebornen Kindern begangen, gehört ebenfalls zu den Scheußlichkeiten, die aus der Unzucht entspringen. - Bürgers Gedicht: "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain"
stellt sehr treffend die Uebergänge von aufkeimender Lust bis zum vollendeten Verbrechen dar.”
|
|
1837
|
Herling, Simon Heinrich Adolf. Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Stylistik. Zweiter Theil. Die stylistische Analyse. Digitalisiert von Google.
“[S. 49: Das Blümchen Wunderhold] Die Sprache ist dem Gegenstande angemessen, sehr einfach, ungeschmückt und populär; eben so leicht und gefällig der Rhythmus.
[S.137: Lenore] In der Ballade hat sich unter den Deutschen vorzüglich Bürger ausgezeichnet, und Lenore ist eine der vorzüglichsten. Ich ziehe sie <der Entführung> vor, welche von
ihm Engel (Siehe dessen <Dichtungsarten> S. 219 u.f.) einer ausführlichen, herrlichen und sehr lobenden Zergliederung gewürdigt hat.
[S. 138] Zwei Strophen scheinen hier zu viel; aber die gottvergessende Verzweiflung und ihre gespenstischen Folgen sollte, in den Jubel der Freude hereintretend, durch den Contrast den
Schauder erhöhen. Alles ist hier der lebendigen, nicht eben diplomatischen, Auffassung des Volks gemäß, wie das Motiv <Erweichten ihren harten Sinn>, was dem Volke bei solchen Festen allein zusagt. Nun wird
die Darstellung, ebenfalls der Auffassung des Volks angemessen, dramatisch.
[S. 139] Alles Andere stimmt zu der Empfindung des geisterhaften Grauens, selbst die malenden Interjectionen: <trapp, trapp, trapp>, <Hurrah>, >Hurre, hurre>,
>hopp, hopp, hopp>, >Sa, sa>, <husch, husch, husch>, zu denen die Darstellungen des Volks neigen, und welche selbst Ausdruck seiner Empfindungen sind: Windessausen, Todtenlieder, Rabengeflatter,
Vorgeschichten, Spuk auf dem Hochgerichte, Mondschein, Rasseln des dürren Laubes, Unkenruf, selbst das bezeichnende <gurgeln> und die Frecheit der gespenstischen Befehle: <Komm, Pfaff...>”
Herlings Analysen in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1837
|
Hinrichs, Herrmann Friedrich Wilhelm. Schillers Dichtungen nach ihren historischen Beziehungen und nach ihrem inneren Zusammenhange.
Erster, lyrischer Theil. Digitalisiert von Google.
“[S. XLV] In Hinsicht der Vertheilung und Anordnung desselben, des Zusammenhangs der Begebenheiten, der wahrhaft dramatischen Bewegung und Ausführung überragt Schiller alle
deutsche Balladendichter, Bürger, Goethe und Uhland nicht ausgenommen. Diese haben wieder andre Vorzüge, die gleichfalls anzuerkennen sind. Und gewiß ist es die dramatische Behandlung des Stoffs, warum Goethe
Schillers Balladen über die seinigen zu stellen scheint. Auch hier ist Handlung, wie überhaupt, weniger seine Stärke, als die äußere Umgebung. Diese und das bloße Schicksal des Individuums ist fast ohne That und
Handlung der ganze Inhalt. Aber die ruhige Klarheit, das Anschauliche der Begebenheit, die wundersame Sprache und Darstellung, der so milde Ton, und der ächt poetische Hauch, der das Ganze belebt und beseelt, wo
fände das seines Gleichen? Bei Bürger tritt die Handlung weniger hervor, wenn gleich bei diesem alles individuell und charakteristisch ist. Von Uhland kann man sagen, er habe von allen denen etwas: von Bürger das
Individuelle, von Goethe das Natürliche, und von Schiller die Handlung. Wenn er auch diese mehr als Bürger hervorhebt, so beschränkt er sie doch auf eine Individualität.”
|
|
1837
|
Hüttenbrenner, Anselm. In: Oesterreichische National Encyklopädie. Bd. 6. Digitalisiert von Google.
“[S. 489] Im April 1835 wurde zu Grätz [Anselm] H[üttenbrenners]. dritte Oper in 2 Acten: "Leonore," nach Bürger´s Ballade, von C. G. Ritter v. Leitner gedichtet, mit glänzendem Beyfall aufgeführt. Im Herbst 1835 dichtete Ignaz Kollmann einen Voract zur Leonore, welchen H[üttenbrenner] alsbald in Musik setzte. ”
|
|
1837
|
Anonym. Mannichfaltiges. Die Psychologie der Waldbäume. In: Allgemeine Forst und Jagdzeitung, Band 110-111. Digitalisiert von Google.
“[S. 72] Die Schwarzpappel und die Canadische Pappel (Populus nigra canadensis) stehen zunächst an den Weiden, sind letzte Staffel des Daseins in der Gedankenreihe, verkörperter Begriff des Zurückgebliebenseins, des verlassenen Dahinscheidens in Nacht und Graus, wie Bürger die Leonore sagen läßt. Man pflanze sie an des Dorfes Kirchhofsmauer. ”
|
|
1837
|
Goethe, Johann Wolfgang von. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823 - 1832. Von Johann Peter Eckermann. Erster Theil. Donnerstag den 12. May 1825. Digitalisiert
von Google
“[S. 220] Nach solchen Äußerungen über die Einflüsse bedeutender Personen auf ihn kam das Gespräch auf die Wirkungen, die er auf Andere gehabt, und ich erwähnte Bürger, bey
welchem es mir problematisch erscheine, daß bey ihm, als einem reinen Naturtalent, gar keine Spur einer Einwirkung von Goethe's Seite wahrzunehmen. ´Bürger, sagte Goethe, hatte zu mir wohl eine Verwandtschaft als
Talent, allein der Baum seiner sittlichen Cultur wurzelte in einem ganz anderen Boden und hatte eine ganz andere Richtung. Und jeder geht in der aufsteigenden Linie seiner Ausbildung fort, so wie er angefangen.
Ein Mann aber, der in seinem dreyßigsten Jahre ein Gedicht wie die Frau Schnips schreiben konnte, mußte wohl in einer Bahn gehen, die von der meinigen ein wenig ablag. Auch hatte er durch sein bedeutendes Talent sich ein Publicum gewonnen, dem er völlig genügte, und er hatte daher keine Ursache, sich nach den Eigenschaften eines Mitstrebenden umzuthun, der ihn weiter nichts anging.´ "
|
|
1837
|
Menzel, Karl Adolf. Karl Friedrich Becker´s Weltgeschichte. Siebente, verbesserte und vermehrte Ausgabe.Elfter Theil. Digitalisiert von Google.
“[S. 313] Bürger (Johann Gottfried, geb. 1748, gest. 1794) strebte darnach, durch Benutzung volksmäßiger Stoffe ein Volksdichter zu werden, erreicht aber mit großem Talent und
einer kräftigen Sprache dieß Ziel nicht, weil er es zu sehr in der Nähe wähnte, und die Noth eines armseligen Hausstandes und unglücklicher Ehen den höheren Aufschwung seines Geistes gelähmt hatte.”
|
|
1837
|
Langbein, August Friedrich Ernst. Langbein´s prosaische Werke. Sechster Theil. Digitalisiert von Google.
“[S. 169] Die Herren vertrieben sich meistens die Zeit mit Kartenspielen, wobei Mancher, der ein paar Gröschlein verlor, Fortunen
deßhalb noch heftiger ausschalt, als weiland der Dichter Bürger, der sie, wie bekannt, öffentlich an den Pranger stellte.”
|
|
1837
|
Langbein, August Friedrich Ernst. A.F.E.Langbein´s sämmtliche Schriften. Fünfundzwanzigster Band. Digitalisiert von Google.
“"[S. 66] Als man dieses Kapitel abgehandelt hatte, ward Antonio zu mehreren Liedern aufgefodert, und er wählte unter andern Bürgers bekannte Ballade: Des Pfarrers Tochter von Taubenhain.
Er nannte sie, ehe er den Gesang anhob, einen Warnungsspiegel für junge, hübsche Mädchen, und bat die anwesenden Jungfern, näher zu kommen. Sie dünkten sich - gerade so, wie die Mädchen in der Stadt - sämmtlich sehr
hübsch, und drängten sich alle heran. Auch Röschen (die Tags vorher den Kanarienvogel, den sie vom Tode losbitten wollte, geschenkt erhielt,) verschaffte sich einen der ersten Plätze. Sie hatte das meiste Recht, dem
Rufe zum Warnungsspiegel für hübsche Mädchen zu folgen; denn sie war unstreitig der schönste Stern des Dorfes und der umliegenden Gegend.
Sie hörte dem Gesang der Ballade sehr aufmerksam zu,
und nahm an dem Schicksale der Pfarrerstochter so lebhaften Antheil, daß ihr Gesicht einige Mal die Farbe veränderte. Dieß geschah besonders bei den Stellen, wo Rosette mit dem Junker von Falkenstein eine nächtliche
Zusammenkunft hat und der schändliche Verführer in der Folge die ihr geschworene Treue bricht. Als die Unglückliche nachher wegen des Verlusts ihrer Unschuld von ihrem harten Vater gemißhandelt und verstoßen wird,
weinte Röschen laut; und der Kindsmord that auf sie eine so erschütternde Wirkung, daß sie bei den Worten: "Mich hacken die Raben vom Rade!" ohnmächtig zu Boden sank und weggetragen werden mußte. Dieser
Vorfall machte dem Konzert plötzlich ein Ende.
Als Antonio des andern Tages abreisen und seine Zehrung bezahlen wollte, sagte Röschens Vater: er habe mit ihm etwas unter vier Augen zu sprechen,
und führte ihn in eine abgelegene Stube, die er hinter sich verschloß. "Ich bin Ihnen viel Dank schuldig, mein Herr!" fing er jetzt an: "Sie haben durch die traurige Geschichte, die Sie gestern
sangen, meine Tochter vom Verderben gerettet. Nehmen Sie dieß kleine Geschenk zum Zeichen meiner Erkenntlichkeit!" - Mit diesen Worten wollte er ihm einen straffen Beutel voll Geld in die Hand drücken.
Antonio trat zurück und bat um Erklärung: wie er zu diesem Anerbieten komme.
"Das sollen Sie erfahren," antwortete der Gastwirth, "wenn Sie mir Verschwiegenheit versprechen."
- Antonio that es und Jener fuhr fort: "Mein Röschen ist, wie Sie werden bemerkt haben, ein junges, schmuckes Ding, und stach schon manchem fremden Herrn, der bei mir einkehrte, in's Auge. Sie war aber
immer sittsam, und wich allen verliebten Nachstellungen aus. So benahm sie sich auch oft gegen einen gewissen Edelmann, der einige Meilen von hier ein verschuldetes Gütchen im Sommer bewohnt und den Winter in der
Residenz zubringt, wo er vom Spiel lebt. Er ist ein junger, wohlgebildeter Mensch, und seine glatte Zunge besitzt die Gabe der Ueberredung, als ob er bei der Paradiesschlange in die Schule gegangen wäre. Dieser
Windbeutel hat denn, wenn ich manchmal den Rücken gewandt habe, dem Mädel in's Ohr gezischelt: sie sey schön wie eine Göttin - verdiene ein besseres Glück, als auf dem Lande zu versauern - er sey bis zum Sterben in
sie verliebt - wolle sie zu seiner Gemahlin machen - sie solle Kleider und Schmuck wie eine Fürstin bekommen, und so weiter. Drauf ist er mit dem Vorschlag einer Entführung heraus gerückt, und hat auch wirklich
die unerfahrne und leichtgläubige Thörin, die noch nicht völlig sechzehn Jahr´ alt ist, zur Einwilligung beschwatzt. Am heutigen Abend wäre sie heimlich fortgegangen, und ich hätte sie vielleicht erst nach langer
Zeit im Lazarethe der Hauptstadt, oder gar - wie jene verführte Pfarrerstochter - auf dem Rabensteine wieder gefunden: wenn nicht Sie, mein Herr, wie ein Bote Gottes in mein Haus gekommen wären! Ihr trefflicher
Gesang zeigte meiner Tochter den Abgrund, vor dem sie stand, und sie entdeckte mir nach vorüber gegangener Ohnmacht ihren Liebeshandel unter Vergießung vieler Thränen der Reue." "Wohl Ihnen und dem guten
Mädchen!" rief Antonio aus. "Ich freue mich herzlich, daß ich - wiewohl nur zufällig - etwas Gutes gestiftet habe. Verfolgen Sie mich aber nicht weiter mit Ihrem Gelde, lieber Mann! Sie schmälern das
kleine Verdienst, das ich mir um Sie erwarb, wenn Sie es mit klingender Münze bezahlen wollen." -”
|
|
1837
|
Marggraff, Herrmann. Ueber deutsche Kritik und Polemik. In: Bücher und Menschen. Bunzlau. Digitalisiert von Google
“[S. 341] Aber zählt die Schlachtopfer, welche seit Lessing, dem Großmeister und taktischen Ordner der Kritik, diesem glühenden Moloch der deutschen Polemik gefallen sind,
und ihr werdet, wenn ihr sie zählen könnt, billig erstaunen. Manchem schon verkümmernden und verhungernden Genie gab diese Kritik den Stich mitten durch's Herz, woran es verblutete. Steigt hinab in die Gräber unsrer
Vorfahren in der Literatur! Hätten sie noch ihre Leichen und die Leichen eine Stimme und die Stimme Verständniß für euch, so würdet ihr erfahren, in welchem Literaturblatt die scharfe, beißende Kritik stand, an der
sie dahin starben! Und wer an der Kritik nicht umkam, hat daran mehr oder weniger seinen Aerger und sein Leiden gehabt. Er hat vielleicht seinen Aerger verbissen, aber der Aerger biß ihn doch. Versetzt euch in jene
stille Kammer literarischen Ruhms und Elends, wo der Lieblingsdichter seiner Nation an der berüchtigten Recension Schiller's siecht und an Gram und Hunger stirbt und an seinem Nachruhm verzweifelt. — Das that Schiller an Bürger!
Andere haben Schiller'n im Grabe dasselbe angethan! Eine gerechte Nemesis geht umher und mordet die Mordenden und erweckt unter den Schriftstellern die Todtenrichter und Bluträcher.“
|
|
1837
|
E.D.J. Rezension Deutsche Dichter von Götzinger. In: Num. 11. Ergänzungsblätter zur Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung. Digitalisiert von Google.
“[Sp. 85] Sehr interessant ist die beygegebene Vergleichung zwischen Schiller und Bürger als Balladendichtern. Er sagt unter Anderem:" Dass unter unseren Balladen die von Bürger und Schiller Lieblingsstücke der Nation geworden sind, ist eine Thatsache, die keines weiteren Beweises bedarf. Diess muss auf den ersten Anblick auffallen; es muss uns wundern, dass zwey Dichter, die einander so unähnlich scheinen, und auch wirklich sind, die Liebe des Volkes so gleichmässig besitzen. Käme es bloss auf gewisse Formen, oder bekannte Gegenstände an, so könnte man sich diess nicht erklären; allein jenes ist nicht der Fall; vielmehr kommen wir hier auf das zurück, was schon so oft in diesem Buche (in der Einleitung) behauptet worden ist: das Wohlgefallen an einer Dichtung beruht nicht auf den äusseren schönen Formen, sondern darauf, dass ein schönes Leben in ihnen wohnt, und sich deutlich ausspricht. Und eben dies Leben ist es, was wir bey beiden Dichtern, trotz ihrer anderweitigen Verschiedenheit, mit Verwunderung wahrnehmen. Es ist aber bey jedem eine andere Natur, eine andere Lebensregung. Aus Bürger's Balladen blickt uns Frische und Gesundheit, Lebhaftigkeit und Feuer, Jünglingskraft und kühner Muth entgegen; aus Schiller's Dichtungen schaut uns Seelengrösse und Herzensreinheit, stiller Ernst und himmlische Ruhe, männliche Kraft und fester Wille an. Jene Frische und Gesundheit artet oft in Derbheit, ja wohl gar in Rohheit (?) aus, diese innere Seelenerhebung in Schwärmerey und Unklarheit (?); immer aber wird uns die Wahrnehmung dieser Lebensreize angenehm und erfreulich seyn."
[Sp. 87] Schiller dagegen lässt in der Regel seine Helden im Kampfe mit der äusseren Welt, dem feindlichen Schicksale, auftreten, und mit der Schilderung dieses Kampfes haben es seine Balladen zu thun. Bürger zeigt sich demnach überall als Liederdichter, Schiller aber als dramatischer, welcher zwar den Sieg des Edlen oder dessen erhabenes Unterliegen vortrefflich darzustellen weiss, dagegen, wo der Gegenstand eine unmittelbare Darstellung der heftigsten Leidenschaft erheischet, sich in erhabenen Wortschwall verliert (Hero und Leander), oder nur schwache Umrisse giebt (Ritter Toggenburg). Nun lässt Hr. G. eine Vergleichung der Charaktere in den Dichtungen beider Dichter folgen, deren Ergebniss ist, dass er bey Schiller lauter ideale, d.h. allgemein gehaltene Gestalten und Charaktere, ohne besondere eigenthümliche Züge, jedoch stets in anderen Verhältnissen, in einer anderen Umgebung, findet, bey Bürger stets individuelle, mit einander nichts gemein habende Charaktere antrifft. [...]
Der vierte Punct, worin beide Dichter, nach Hn. G's. Ansicht, sich unterscheiden, die Reinheit der Sprache, scheint uns weniger
begründet. Unleugbar schreibt Bürger rein, und zeigt die grösste Genauigkeit im Gebrauche richtiger Sprachformen. Können und dürfen wir aber Schillern desshalb das Gegentheil Schuld geben, weil er nicht, wie Bürger,
der überall das Volkslied nachahmte, der Sprache des täglichen Lebens huldigt?
[Sp.88] Wahrheit und Anschaulichkeit, womit Alles, das Ganze, wie das Einzelne, vor uns tritt, ist allerdings ein Vorzug der Goethe´schen Balladen, welchem aber Bürger's Wärme und Innigkeit, wie Schiller's Tiefe und hohe Gesinnung, nach der Meinung des Vfs. mit Recht entgegengestellt wird.”
Die vollständige Rezension in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1837
|
Jeitteles, Ignaz. Aesthetisches Lexikon. Zweiter Band.
“[S. 336] Das Sonett ist ein in einem eigenen Rahmen eingefaßtes Gemälde, und ist daher nur dann gelungen, wenn, wie Bürger, selbst Meister und Wiederhersteller des
deutschen Sonettes, es charakterisirt, sein Inhalt ein kleines, volles, wohl abgerundetes Ganzes ist, das kein Glied merklich zu viel oder zu wenig hat, dem der Ausdruck überall so glatt und faltenlos als möglich
anliegt, ohne jedoch im mindesten die leichte Grazie seiner hin- und herschwebenden Fortbewegung zu hemmen.
[S. 505, Rezension Bürgers Lehrbuch der Aesthetik, Hg. Karl v. Reinhard, 1825]
Sicherlich würde sein Lehrbuch in vollkommnerer Gestalt erschienen seyn, hätte er es selbst
herausgegeben. Neben dem Heerschilde einer früheren Geistesperiode, auf welchem die Namen von Baumgarten, Moses Mendelssohn, Sulzer, Adelung, Eschenburg, Home, Hurd, Gerard und andere verzeichnet stehen, spielt
Kant's Kritik der Urtheilskraft in ihrer durchgeführten Anwendung eine Hauptrolle, eben nicht die glücklichste. Bürger unterwirft sich durchgängig und unbedingt den Lehren des Philosophen, oft mit buchstäblicher
Treue. Obwohl die Darstellung keine eigenen Erläuterungen beibringt, kann sie wegen ihrer Faßlichkeit dennoch Anfängern zu einer Vorbereitung auf das Studium der Kantischen Schrift dienen.
[S.
506] Bürger´s Dichtername erregt von seiner Poetik größere Erwartungen als im Ganzen erfüllt werden, womit einzelnen Partien keineswegs ihr Verdienst abgesprochen werden soll. [...]
Bürger hat
sich als Balladendichter, wie viel ein reiner Geschmack auch hier und da noch vermissen mag, unverwelkliche Lorbern gesammelt; um so gespannter richtet sich die Theilnahme seiner Verehrer auf dasjenige, was er über
die Romanze und Ballade sagt. Gerade hier ist die Ausbeute auffallend gering. Einen innern Unterschied zwischen der Romanze und Ballade scheint Bürger, gleich mehren neuern Aesthetikern, nicht angenommen zu haben,
wenigstens läßt er sich darüber nicht auf Gränzberichtigungen ein. Ueber das Epos haben die Aufklärungen unserer Tage so vielfaches Licht verbreitet, daß Bürger´s Vorarbeit dadurch sehr merklich in Schatten gestellt
worden ist.“
Die vollständige Rezension in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1837
|
Bothe, Friedrich Heinrich. Janus. Geschichte, Literatur und Kunst. Digitalisiert von Google.
“[S. 35] Die Schlegelsche Schule, von mächtigen Leidenschaften bewegt, verzweigte sich durch ganz Deutschland, zur großen Gemüthsergötzung schongeisterischer Fraubaserei. Statt
gründlicher Untersuchungen dienten die Parteiworte Objektiv und Subjektiv. "Wehe den Subjektiven! Wehe dir, Klopstock, du armer, in Lyrik erstickter Epiker! Wehe dir, potenzirter Kotzebue, genannt Schiller ! *) Wehe dir, unplastischer Wieland,
Echo nur der französischen und etwa der griechischen Vorsänger, ohne eine Ader von Calderon! Nur Göthe soll leben, Göthe, der Objektive, Formale, Plastische, der
Naturdichter, der Mann aller Farben und Tendenzen!" So erscholl es von der Oder bis zum Rhein. Es war ein Geistersturm, der alles Schwache schonungslos niederwarf, aber die starken Eichstämme nicht beugte.
*So rächte Göttin Nemesis Schillers Rezension des ächtdeutschen Bürger, jene pedantisch einseitige Rezension, die Bürgers Herz brach, und späterhin selbst des ernüchterten Kritikers Bewußtseyn trübte. Wenn, biblisch zu reden, das Salz dumm wird, wenn die Weisen selbst rasen, was ist von den Thoren zu erwarten?”
|
|
1837
|
Bilder-Conversations-Lexikon, Leipzig F.A. Brockhaus
“[Bd. 1,S.351] der berühmteste unter den deutschen Volksdichtern, geb. 1. Jan. 1748 zu Wolmerswende im Halberstädtischen, wo sein Vater Prediger war, ward bis in sein zwölftes Jahr in
seiner geistigen Ausbildung sehr vernachlässigt.[...] Daher ging er 1768 nach Göttingen und wendete sich von der Theologie zur Rechtsgelehrsamkeit, gerieth aber von Neuem in seinen frühern unregelmäßigen
Lebenswandel, sodaß sein Großvater, dessen Unterstützung ihm bisher fortgeholfen hatte, ihm dieselbe ganz entzog. B. gerieth dadurch in Verhältnisse, daß man ihn kennen und schätzen mußte, um seine Nähe nicht zu
meiden. Indessen nahm sich jener literarisch berühmte Freundekreis seiner an, zu dem Hölty, Voß, die Grafen Stolberg und K. F. Cramer gehörten, und trotz aller Misverhältnisse stählte sich seine Dichterkraft durch
eifriges Studium alter wie neuer, besonders span. und engl. Muster. Schon hatten einzelne seiner Gedichte Aufmerksamkeit erregt, als es 1772 seinen Freunden glückte, ihm die wenig einträgliche Stelle eines
Justizamtmanns zu Altengleichen zu verschaffen, was ihn zugleich mit seinem Großvater versöhnte, der ihm nun 800 Thlr. zu der erfoderlichen Bürgschaft und Bezahlung seiner Schulden vorschoß. Bald nachher erschien
seine berühmte Ballade »Leonore«, welche mit der spätern, »Der Pfarrerstochter von Taubenheim« und andern, des Dichters Namen bald durch ganz Deutschland nennen machte.”
|
|
1837
|
Anonym. Deutsches Lesebuch von Wilhelm Wackernagel. In: Blätter für literarische Unterhaltung, 3. November, Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 1248] Bei Goethe konnte außerdem die spätere didaktische Richtung noch etwas stärker bezeichnet werden, als geschehen ist; bei Schiller hätte die früheste Periode nicht ganz leer
ausgehen dürfen. Schiller's ´Glocke´ ist ebenso wie Bürger´s ´Lenore´ wol deshalb weggeblieben, weil beide Gedichte zu bekannt sind; doch finden sich andere, die es nicht minder sind, und wenigstens die ´Lenore´ ist
von zu großer Bedeutsamkeit für die deutsche Poesie gewesen, als daß sie weggelassen werden durfte. “
|
|
1837
|
Hermann, Paul. Die Hochzeit. In: Die Altenburger. Zeitz. Digitalisiert von Google
“[S. 63] Jeder Gluhtblick, den er ihr mit maliciöser Deutlichkeit zuwarf, vermehrte bei dem Onkel den Reiz zu seinem vertrakten Husten, während er bei mir wie der Blitz in eine
Pulvertonne, so in das Hauptquartier meiner Empfindung drang, in welchem Dame Eifersucht von den Liebesgöttern fortwährend den entsetzlichsten Zitterwalzer aufspielen ließ.
´Knapp´ sattle mir mein Dänenroß,
Daß ich mir Ruh´ erreite!
Es wird mir hier zu eng´ im Schloß,
Ich will und muß in's Weite!´
hustete der Onkel mit schadenfrohem Lächeln. “
|
|
1837
|
Müller, Niklas. Liederbuch für die Veteranen der grossen Napoleonsarmee von 1803 bis 1814. Mainz. Digitalisiert von Google
“[S. 257] Erinnerungsfeier am Maria Himmelfahrtstage, angeordnetes Geburtsfest von Napoleon.
(Den 15. August 1769.)
Singweise: Ein Pilgermädel jung und schön, u. s. w. ´Bruder Graurock´, Ballade von G. A. Bürger. Eigene Melodieen von verschiedenen
Tonsetzern.
[S. 115] Die Veteranen an ihre Brüder Festordner.
Singweise: Trinkt und lasset frohen Muth u.s.w. Hiller
nach Langbein. S. 120 von Methfessels Sammlung.
Oder: Mihi est propositum u.s.w. von Gualterus de Mapes.
Oder: Ich will einst bei ja und nein u.s.w. Von G. A. Bürger
[S. 130] Erinnerungen an Napoleon auf Elba.
Singweise: Mit naßgeweintem Schleier, u.s.w. ´An Agathe´ Von G. A. Bürger. Auch neuere Komposition von M “
|
|
1837
|
Anonym. Modeworte und Moderedensarten der neuern Zeit. In: Blätter für literarische Unterhaltung, 27. September. Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 1095] Welcher Schriftsteller aber diese oder jene der hier erwähnten neuen Redensarten zuerst gebraucht habe, das läßt sich schwerlich so bestimmt nachweisen, als sich nachweisen
ließ, daß Gellert, der noch keine der hier als neu angeführten Redensarten kannte, das Wort naif (naiv) in der Einleitung zu seinen Briefe (S. 79) zuerst gebraucht habe. Schwerlich dürfte auch Bürger´s bekanntes Sprüchlein:
Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht,
Der hat aus dem Häckerling Gold schon gemacht,
auf den Erfinder der einen oder der andern jener Redensarten seine Anwendung leiden. “
|
|
1837
|
Adolphi, Felix. Shelley´s Leben. In: Die Cenci, Trauerspiel von Percy Bysshe Shelley. Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 13] Die modernen lateinischen Verse haßte er; dagegen beschäftigte er sich eifrig mit der deutschen Sprache und Literatur, die, wie er selbst sagt, seinem Hang zum Mystischen
und Romantischen besonders zusagte. Er glaubte damals an Geistererscheinungen und es ist keine Fiction, wenn er sagt:
While yet y boy I sought for ghosts and sped
Through many a lonely chamber, cave and ruin
And starlight wood, with fearful steps pursuing
Hopes of high talk with the departed dead.
Bürgers Leonore war eine Zeit lang sein Lieblingsgedicht. Er schrieb in dieser Periode ein Epos in sechs oder sieben Gesängen, betitelt ´der wandernde Jude.´ “
|
|
1837
|
Owen, Robert Dale. Notes. In: Pocahontas: A historical drama, in five acts. New-York. Digitalisiert von Google
“[S. 230] Page 146.
My heart is straitened here
Within this fort. I must abroad, abroad!
I have forgotten which of the German poets it is, who has a ballad, beginning:
Knapp! sattle mir mein Degenross,
Dass ich mir Ruh´ erreite;
Es ist mir hier zu eng´ im Schloss,
lch will - ich muss - in's Weite! “
|
|
1837
|
Laßberg, Frid. v. Sagenwanderungen und Umdichtungen. In: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Karlsruhe. Digitalisiert von Google
“[S. 311] Sein Lied von der Treue aber hat die Quelle in dem altfranzösischen: Do chevalier á l 'Epée, zuletzt gedruckt in Méon nouv. recueil se fabliaux Paris I, 127
Frau Schnips findet sich ebenfalls in einem altfranzösischen Gedichte, überschrieben: de celui qui conquit Paradis par plaidant, abgedruckt aus einer alten Handschrift der Stadtbibliothek in Bern in den Extraits de quelques posies du XII, XIII, XIV. Siécle. Lausanne chez Grasset 1739 “
|
|
1837
|
Anonym. Rez. The Penny Cyclopaedia Letters B and C. In: The Mechanics' Magazine, Museum, Register, Journal, and Gazette. London. Digitalisiert von Google
“[S. 78] The literary information is often as imperfect as the political. We are told of Bürger the German poet, that ´his Leonora has been translated into English - Bürgers Leonora by
Wm. Robert Spencer, fol. London, 1796.´ We beg to inform the biographer that Bürger's Leonora, or rather as it is usually written Lenora, has been eight times translated into English; one of the said translations
having been the first production of an obscure Edinburgh lawyer, who afterwards attained some notoriety by writing ´Religious discourses,´ and pamphlets on the banking system - one Walter Scott. This life of Bürger
is remarkable for other omissions, which are not here worth particularizing.“
|
|
1837
|
Engelmann, Wilhelm. Bibliothek der schönen Wissenschaften oder Verzeichniß [...] Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 42] Bornschein, Ernst, des Pfarrers Tochter von Taubenhain. Eine wahre Geschichte nach Bürgers Ballade neu bearbeitet. 6. sehr verb. Aufl. Mit 2 Kpf. 8, Eisenberg 840. Schöne. “
|
|
1837
|
Sowinski Albert. In: Musiciens Polonais. Paris. Digitalisiert von Google
“[S. 516] COMPOSITIONS DRAMATIQUES.
Lenore, drame lyrique en deux actes, poème d' Ed. d' Anglemont, sur la ballade de Burger, Les morts vont vite, à quatre personnages,
deux chœurs et orchestre (inédit).“
|
|
1837
|
Anonym. Visit to the Salt Mines of Salzburg. In: The New Monthly Magazine and Humorist. London. Digitalisiert von Google
“[S. 28] Thus, one by one, my companions disappeared, till I was left alone with a rough young gnome behind. ´Hurrah, the dead can ride apace, dost fear to ride with me?´ from Burger's
Eleonore,* was ringing in my ears ; but before resigning myself to my fate, I will enlighten the mind of the reader by a brief natural history of this mysterious steed.
* From the elegant translation of this popular German ballad, by William Taylor, Esq., of Norwich.“
|
|
1837
|
Kirchhoff, W. Hugh! In: Sundine 21. Februar. Stralsund. Digitalisiert von Google
“[S. 64] Besonders gerührt war man an einer gewissen Wegestelle, wo man schroff mehrere Fuß hoch in einen reißenden Waldbach hinabfuhr und nun durch Wasserwirbel, Eisschollen und
Unebenheiten aller Art sich an das jenseitige Ufer durcharbeiten mußte, um eine fast noch gefährlichere Landung zu wagen. Man konnte der Versuchung nicht widerstehen, an Bürgers Lied vom braven Manne zu denken. ´Wer
ist der Brave? Ist's der Graf?´ Nein, diesmal waren es vier schwarze Engländer, die meinen Freund B., der zwar kein Zöllner ist, aber doch in jenen verhängnißvollen Strudeln kämpfte, glücklich auf den Continent
brachten.“
|
|
1837
|
W. M. Magister Isaak Stiefelius oder die Schul-Excellenz. In: Sundine, 14. August. Stralsund. Digitalisiert von Google
“[S. 258] Ihr ganzes Commando bestand in einem jämmerlichen Zetergeschrei, das sie von Zeit zu Zeit erhob, wenn ihr ein Husar heimlich mit dem Ellbogen in die Seite stieß, oder ein
spaßhafter Lieutenant ihr das Pistol zeigte und abzufeuern drohte, dann, o dann schrie unser arme Freund so mächtig, daß es hätte einen Stein erbarmen mögen, und nicht die Herzen dieser gefühllosen Horde, welche mit
schadenfrohem Gelächter zusah, wie er bereis Hut und Perücke verloren und auf seinem, durchaus unregiersamen Klepper so jämmerlich mit den Beinen zappelte, wie die Prinzessin Europa in Bürgers Ballade. “
|
|
1837
|
Schilling, Gustav. Der Mann wie er ist. In: Sämmtliche Schriften. Zwei und sechszigster Band. Dresden und Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 5] Dinchen schob ihm ein goldnes Vergißmeinnicht, die Frucht ihrer Ersparnisse, an den Finger, Moritz heftete eine goldene Nadel mit dem prangenden M in ihr Busentuch und der
Postknecht blies, des Wartens müde, Allons enfans etc. Lebe wohl! rief sie mit den Worten der vergötterten Molly:
Lebe wohl, Du Mann der Lust und Schmerzen,
Mann der Liebe, meines Lebens Stab!”
|
|
1837
|
Langbein, August Friedrich Ernst. Thomas von Pampel, Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 62] Aber sie
theilte keinen aus; denn die jungen Flattergeister standen bei ihr in dem Verdacht, sie hätten meistens den Wahlspruch: ´Ein andres Städtchen, ein andres Mädchen!´ Drum ließ sie sich gar nicht mit ihnen ein, sondern
befolgte Bürgers Warnung:
´Traut, Mädchen, leichten Rittern nicht;
Manch Ritter ist ein Bösewicht.
Sie löffeln wohl und wandern,
Von einer zu der andern,
und freien keine nicht.´
Mit dem einzigen Herrn von Pampel machte das vorsichtige Trudchen eine Ausnahme. Er schien ihr zu schwer und zu
gediegen, als daß er flatterhaft seyn könnte.”
|
|
1837
|
Stückrad, Georg. Der Buchhandel. In: Programm für das Gutenbergs-Jubiläum, Offenbach. Digitalisiert von Google
“[S.
99] Die Schriftsteller – je nun, Schriftsteller von Profession, Literaten, Privatgelehrte gab es noch nicht. Christian Felix Weiße war Kreissteuereinnehmer, Christian Fürchtegott Gellert Professor extraordinarius zu
Leipzig. Jeder hatte ein Aemtchen, das ihn ernährte, in dem er sich glücklich fühlte, und auf Honorar wurde in dem Haushaltungs-Budget nicht gerechnet, so wenig als auf Beförderung durch allerhöchstwohlgefällige
Zeitungsartikel. Politik, Kritik und manche böse . . . . ik war den meisten Scribenten ein unbekanntes Feld. Daher waren denn die Schriftsteller in ihren Forderungen bescheiden, und schrieben aus innerem Drang,
nicht aus äußerer Bedrängtheit, und wenn auch Jung-Stilling, wie er selbst erzählt, den Kohlenbauer mit dem kaum entsiegelten Honorar befriedigte, so hatte er doch nicht seine Jugend beschrieben, um Kohlen kaufen zu
können. Bürger rühmt in Versen, daß wohlgezogene Verleger den Bogen Gedichte mit einem Louisd'or honorierten, er ahnte nicht, daß den späteren Herausgebern seiner Gedichte für entbehrliche Vorreden und langgedehnte
Biographie vollwichtigere Louisd'ors zu Theil werden würden als ihm selbst für seine Lenore. Allmählich wurde die Schriftstellerei Handwerk oder, wenn man lieber will, Gewerbe, Fabrikation, Spekulation und der
Buchhandel der Pharotisch, woran gierige Spieler pointierten, und ein ebenso gieriger Banquier die volte schlug. Hinc illae lacrymae! So lange man ein Geschäft ehrenhaft betreibt, hat es einen goldenen Boden, setzt
sich aber die Gewinnsucht an das Comptoir, so heißt es rouge ou noir, und es geht wie in der Fabel: die Henne, welche in einem Tag zwei Eier legen sollte, legte gar nicht mehr.”
|
|
1837
|
Anonym. Karl von Dalberg. In: Janus. Geschichte, Literatur und Kunst, Zürich. Digitalisiert von Google
“[S. 158] Die Zusendung dieser Gedichte
erwiederte der Großherzog durch folgendes Handschreiben, das von einer schweren goldenen Denkmünze begleitet war:
Hochgeehrter Herr!
Gewiß verdient das Bestreben, die Sprache dichterischer
Begeisterung dem Gesang näher zu bringen durch anmuthsvolles Abwechseln bestimmt-kurzer und bestimmt-langer, höherer und tieferer Laute den Dank aller Freunde des Schönen. Mit Wonne liest Jeder Klopstocks Oden,
Bothe's Euripides, Bürgers Lenardo. Mit eben der Wonne wird Ihre Sammlung gelesen werden.”
|
|
1837
|
Anonym. Kurier der Theater und Spectakel. In: Der Wanderer, 29. Juni. Digitalisiert von Google
“Der Bassist Draxler, welcher uns in Kurzem
verläßt, um sein neues Engagement im Hofoperntheater in Wien anzutreten, gab zu seinen Abschiedsbenefize die H üttenbrenner'sche Oper: ´Lenore´, neu in die Scene gesetzt. Die Musik wußte auch wie früher den Kunstsinn zu befriedigen; dem Gemüthe blieb etwas zu wünschen übrig. Die Aufführung geschah mit regem Fleiße. Dlle. Eschen, der Benefiziant und Hr. Tichatschek wurden lärmend applaudirt und öfter gerufen.”
|
|
1837
|
Anonym. Nichtpolitische Nachrichten. In: Kourier an der Donau (Donau-Zeitung), 08.04.
“Ein König in England hat einmal seinen Gelehrten eine
schwere Preisfrage vorgelegt. Er trug ihnen nämlich auf, zu untersuchen, woher es käme, daß wenn ein Fisch in ein Gefäß mit Wasser gethan würde, dieses doch nachher nicht mehr wöge, als vorher. Die gelehrten Herren
zerbrachen sich lange den Kopf über den Grund der Erscheinung, bis endlich einer darauf kam, zu fragen, ob denn die Sache überhaupt wahr wäre. Und da zeigte es sich denn, was der gesunde Verstand einen Jeden hätte
lehren können, daß das Gefäß um so viel mehr wog, als das Gewicht des Fisches betrug. Hans Bendix hätte dieß seinem Abt auch sicherlich gesagt. Der König hatte nur einen gnädigen Scherz getrieben.”
|
|
1837
|
Schleier, Ludolph. Gänsekiel und Geige. In: Thalia, Hamburg.
“[Sp. 291] Verliebt war Sternheim auch. Eigenlich ist das Selbstverstand; bei Leuten
gleich ihm ist das Verliebtseyn eine Idiosynkrasie; es ist ihr Element, wie dem Fische das Wasser, dem Hamburger das naßkalte Wetter, dem Faulen das dolce far niente. Darüber wären wir also einig; wie aber hieß der
Gegenstand von Sternheim's Verliebtheit?
Lenore! Es war nicht die Bürger'sche, die um's Morgenroth aus schweren Träumen empor fuhr; au contraire, sie schlief immer bis zum hellen Tage und wenigstens
bis um 9 Uhr Morgens, wo ihre Zofe den Kopf durch die Thür steckte und halblaut fragte: ´Schlafen Mamsell noch?´”
|
|
1837
|
Mair, W. Von Salzburg bis Kufstein. In: Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt, Wien, 6. Mai
“[S. 362] Endlich nach viermaligem
Rapporte, in welchen sie uns immer getreulich berichtete, wie der Eine just gerade kein Roß zu Hause habe, der Andere kein Wagerl, der Dritte keinen Bub´n, u.s.w.; hatte sich endlich der Bäcker entschlossen, uns ein
herz- und magenerschütterndes Schweizerwagerl, seinen Fuchsen und einen kutschirenden Mühljüngling zu senden, die uns entführen sollte:
Und hurre, hurre, hopp, hopp, hopp,
Ging's fort, in sausendem Galop,
Daß Kies und Funken stoben -
Wir saßen seufzend oben!”
|
|
1837
|
Anzeige. In: Blätter für Scherz und Ernst 22.1.
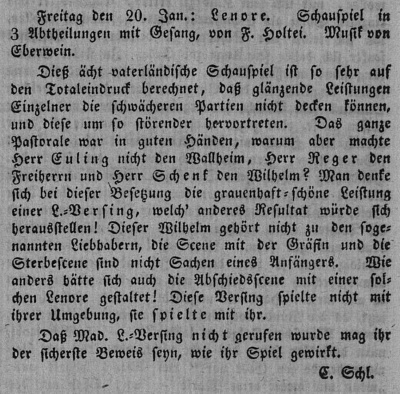
|
|
1838
|
Schilling, Gustav. Versuch einer Philosophie des Schönen in der Musik, oder Aesthetik der Tonkunst. Digitalisiert von Google.
“[S. 265] Als End-Resultat dieser ganzen Betrachtung ergiebt sich, dass das Komische nichts Anderes ist, als die ästhetische Form eines Gegenstandes, der durch eine witzige und sinnreiche, oder witzig und sinnreich scheinende Composition in Verhältnisse tritt, in welchen er lächerlich erscheint. Und diese Form nun gestaltet sich in der Musik hauptsächlich
durch den Kampf des metrischen Gesetzes mit der freien Willkühr, welche gleichsam ausgeht auf eine gänzliche Zerstörung des Rhythmus, indem ich nämlich unter diesem hier ganz im Allgemeinen verstehe: die
Schönheit der Bewegung, die successive Bewegung nach gewissen bestimmten Verhältnissen; die Art und Weise in der Taktfüllung, die sich nicht blos auf die Quantität oder das Maass der Zeit, sondern auch auf dessen
verschiedene Anschauung oder die Qualität des Tones bezieht; eine abgemessene Reihe von Tönen mit Einschluss sowohl der extensiven als intensiven Art der Bewegung, die überall herrscht, in der Melodie wie in der
Harmonie, im Takt, wie in der Accentuation und in den Passagen und Figuren, im Gesange wie in der Instrumentation. Auf dieser stark in das Ohr fallenden Regellosigkeit im Rhythmus beruht selbst das Komische mancher
guten scherzhaften Dichtungen z.B. in BÜRGER´S bekanntem Gedichte "Der Kaiser und der Abt," oder des Pater ABRAHAM A SANCTA CLARA bekannter Fischpredigt.”
|
|
1838
|
Blumenhagen, Wilhelm. Wanderungen durch den Harz. (Sammlung Helmut Scherer)
“[S. 130] Als wir Schweiss-bedeckt den steilen Fusspfad erstiegen hatten, an den Resten der äussersten Ringmauer [der Burg Falkenstein] Athem schöpften [...], recitierte der kleine
Fränzel die schaurige Ballade, die ein Kind dieses Ortes ist:
“Im Garten des Pfarrers von Taubenhain [...]”
und erinnerte uns dadurch an August Bürger, den bei Lebzeiten vielfach Verkannten, der so
schwer trug am gewöhnlichen Dichterloose, den ächten Volksdichter, den noch Keiner übertroffen hat oder zu ersetzen vermochte, wenn auch die jüngstzeitigen Lobhudeleien der poetischen Kameradschaften gern seinen
wohlverdienten Kranz zerfetzen und an ihre Genossen vertheilen möchten.”
|
|
1838
|
Anonym. Rezension Eugen Neureuther: des Pfarrers Tochter von Taubenhain, Lenore und der wilde Jäger von Bürger.
In: Kunst-Blatt. Hg. Ludwig Schorn. Digitalisiert von Google.
“[S. 347] Des Pfarrers Tochter.
[...] In dem reichen, die einzelnen Scenen trennenden Laubwerk und Gewinden bieten dem aufmerksamen Auge sich vielfach Bezüge zum Gedicht dar,
wie der Geier, der die Taube würgt usw. Tiefe Empfindung beseelt die Gestalten, mit ergreifender Schönheit ist der Moment des Mordes geschildert.
Lenore
[...] Es ist dem Künstler auf
bewundernswürdige Weise gelungen, dem Dichter Schritt zu halten in der Scene, wo die Mutter umsonst sich abmüht, ihr verzweifelndes Kind zu Vernunft zu bringen. Gegenüber der Moment des ausbrechenden Wahnsinns, oder
nach dem Gedicht, wo Wilhelm sie abholt. Ueber diesen nur von Architektur, mit einigen Passifloren eingefaßten Bildern, zieht sich in der Breite des Blattes die Heimkehr des Heeres hin, wobei Lenore nur ein Glied in
der langen Kette ist, eine Darstellung, ohne die das Ganze ohne Anfang seyn würde und die sich durch großen Reichthum lebendiger Motive auszeichnet.
Der wilde Jäger
[...] Die Composition dieses
Blattes halte ich in Betreff der Anordnung für die gerundetste von allen, wie sie auch in Betreff der Lebendigkeit der Zeichnung keinen Wunsch unbefriedigt läßt.”
|
|
1838
|
Böttiger, Karl August. (Den 15. Juli 1798 bei Wieland in Osmanstedt.) In: Literarische Zustände und Zeitgenossen. Erstes Bändchen. Digitalisiert von Google.
“[S. 222] Über Bürger. Sein hohes Lied habe ihm stets die widrigste Empfindung gemacht, weil es der Frau eines Andern gegolten hätte. Diese Art von Galanterie war Wielanden von jeher am
unausstehlichsten. Bürger besuchte ihn grade zu der Zeit, wo er dies Lied im Musenalmanach eingerückt hatte und große Lobsprüche zu empfangen hoffte. Wieland hatte seit drei Monaten den ihm von Bürger zugeschickten
Musenalmanach ungelesen liegen lassen und mußte ihm dies auf endliches Befragen grade heraus gestehen. Bürger gestand ganz unbefangen, daß dies das Gedicht sei, mit dem er selbst am meisten zufrieden wäre. -
Die erste Bekanntschaft mit Wieland stiftete Bürger dadurch, daß er Proben seiner jambischen Übersetzung Homer's für den Mercur einschickte. Diese entzückten Goethen und Wielanden dermaßen, daß sie
damals in Weimar und Gotha von den Fürstenkindern eine so ansehnliche Subscription zu erpressen beschlossen, die Bürgern Muße geben könnte, das Werk auszuführen. Aber der veränderliche Dichter gab die Idee selbst
auf.”
|
|
1838
|
Anonym. Karlsruher Kunstausstellung, im Juni 1837. In: Kunst-Blatt, 1. Februar, Stuttgart und Tübingen. Digitalisiert von Google
“[S. 39] Zu den ernsteren und aus der Sphäre der Dichtung genommenen Gegenständen ist noch zu nennen Bürgers Lenore, von Steinheil in Paris. Hat eine Auffassung, deren Originalität im ersten Augenblicke fast ins Schreckhafte geht. Auf hellem Himmelsgrunde erblickt man eine stehende, schwarzgekleidete Nonne, ganz so wie man Aebtissinnen als Porträts, in ruhiggehaltener Stellung, in Klöstern findet. Doch vor ihren Füßen hat sich ein Mädchen zur Erde geworfen, das sich in die rabenschwarzen Haare greift und nur vom Rücken gesehen wird. Die Kleidung ist gemein bürgerlich, braun, ein armes Häuschen, man begreift nicht, wie die Nonne bei ihr sich so wenig rührt. Aber hinten liegt eine Stadt, und wenn wir von der Anhöhe, wo beide Personen sich befinden, herunter schauen in die Tiefe, so zieht in vielbewegten, gutgezeichneten Figuren ein Kriegerheer heim, und von den Stadtmauern, nahe dem Thore, sehen Viele solches heimziehen. Lenore hatte also während des Zuges schon ausgekundschaftet, daß ihr Geliebter nicht zurückkehre, weil er im Felde geblieben, und hatte in der Verzweiflung ihre nächste Zuflucht zu dieser Klosteranhöhe genommen. Ein finsterwaltender, romantischer Geist blickt aus dem Bilde, aber gerade die Hauptfigur ist zu einer groben Wirklichkeit erstarrt, und eine so kalte Tröstung von einer Klosterfrau muß da überall zu spät kommen. Die Mutter im Gedichte war dem Herzen der Tochter näher, und wenn leztere sich dennoch der Verzweiflung überläßt, so wird das tiefe Mitgefühl jener um so rührender. Wollte der Künstler, so ven der Dichtung abweichend, vielleicht mit der Nonne es ausdrücken, daß auch die heilige Zusprache der Religion die Unglückliche nicht mehr zu retten vermochte? Immer bleibt das Bild sehr beachtenswerth.“
|
|
1838
|
Ortlepp, Ernst. W. Shakespeare´s dramatische Werke, übersetzt von Ernst Ortlepp. Erster Band, Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 71] Anmerk. d. Uebersetzers. Die meisterhafte Uebertragung dieser Verse von Bürger, welche schon Schiller ohne Bedenken in seine Bearbeitung herübernahm, wurde auch hier mit
nur einigen geringen Veränderungen beibehalten.“
|
|
1838
|
Kannegiesser, Karl Ludwig. Abriß der Geschichte der deutschen Literatur. Digitalisiert von Google.
“[S. 77] Gottfried August Bürger [...], stets gedrückt von häuslichen Leiden, voll Kraft und tiefen Gefühls, ist der Gründer der Ballade bei den Deutschen, wie er denn besonders durch
seine Lenore zum Volksdichter wurde, und außerdem ein trefflicher Liederdichter, wiewohl seine Darstellung des Natürlichen und Sinnlichen bisweilen grell und derb ist, weßhalb ihn Schiller bitter tadelte. Auch
übersetzte er den Macbeth, und einige Gesänge der Ilias zuerst in Jamben, dann in Hexametern, nicht ohneGlück.”
|
|
1838
|
Anonym. Die jüngste Kunstausstellung in Braunschweig. In: Euterpe. Blätter für Geselligkeit, Literatur und Kunst. Bamberg. Digitalisiert von Google
“[S. 683] Fast dieselbe Aufmerksamkeit wurde der Lessing'schen Leonore zu Theil, welche Du dem jungen Maler S. zum Studium so angelegentlichst empfahlst, deren glückliche Composition Dir so viele Freude machte. Der Nachbildner Bürger's hat sich selbstständig genug bewiesen, um eine Leonore zu malen, welche, wenn auch kein Vers in dem Bürger'schen Gedichte zu diesem Gemälde paßt, doch die Bürger'sche Leonore darstellt. Der Dichter vermag es zu sagen: Zerraufte sie ihr Rabenhaar u. s. w.; der Maler aber nicht. Der Dichter malt viele Scenen; nicht so der Maler, der in einem engen Raume nur eine Situation darstellen kann. Die Masse der Gedanken, welche zwischen den einzelnen Versen eines guten Gedichtes liegen, hat auch hier der Maler empfunden und dargestellt. “
|
|
1838
|
Hoffmeister, Karl. Schillers Leben, Geistesentwickelung und Werke im Zusammenhang. In: Supplement zu Schiller´s Werken. Erster Theil. Digitalisiert von Google.
„[S. 295] Vor einer solchen Kritik vermochte denn freilich auch die Muse Bürger's nicht zu bestehen. Schiller, welcher im April 1789 in Weimar Bürger's persönliche Bekanntschaft
machte, hatte ihn im Leben so, wie in seinen Gedichten gefunden: bieder, populär, aber auch zuweilen platt; "vom Platten aber ist der Idealist ein geschworner Feind". Unser Kunstrichter behauptet nun:
Bürger's Produkten fehle deßwegen die letzte Hand, weil - sie ihm selbst fehle, er könne deßwegen seinen Gegenstand nicht idealisiren, weil das Ideal von Vollkommenheit sich in seiner eigenen Seele nicht
verwirklicht habe.
Dieser ideenreichen Beurtheilung fügte ihr Verfasser eilf Iahre später, als er sie in den vierten Band der Sammlung seiner kleinen prosaischen Schriften einrückte,
die Anmerkung bei, daß er auch jetzt seine Meinung nicht andern könne, aber sie mit bündigeren Beweisen unterstützen würde, denn sein Gefühl sei richtiger gewesen, als sein Räsonnement. In den allgemeinen
Behauptungen scheint er besonders in Folgendem gefehlt zu haben.
Den verfeinerten Kunstsinn, heißt es, befriedigt nie die Materie, sondern nur die Schönheit der Form, nie die Ingredienzien, nur die Feinheit der Mischung. Wenn dieses wahr ist, wie kann der Verfasser auf den vorhergehenden Seiten von einer dem Dichter nothwendigen glücklichen Wahl des poetischen Stoffes reden, die sich nur an das halten soll, was dem Menschen als Menschen eigen ist? und wie kann er der Bürger´schen Muse ihren sinnlichen Charakter vorwerfen? Die Schönheit der Form kann sich ja auch am Speziellsten zeigen, und auch das Sinnliche läßt sich "fein mischen."
Mit diesem Widerspruch der Ansichten hängt noch ein anderer Fehlgriff zusammen. Schiller rechnet zur Idealisirung des poetischen Stoffes auch das, daß das Individuelle und Lokale
zum Allgemeinen erhoben werde. Namentlich soll der lyrische Dichter keine Seltenheiten, keine streng individuelle Charaktere und Situationen darstellen; er darf eine gewisse Allgemeinheit in den Gemüthsbewegungen, die er schildert, nicht verlassen. Die späteren Bürger´schen Gedichte werden getadelt, weil sie großentheils Produkte einer solchen ganz eigenthümlichen Lage seien, deren Unideales, welches von ihr immer unzertrennlich sei,. den vollständigen und reinen Genuß sehr störe. Schiller verwechselt aber hier das Allgemeine mit dem ächt Menschlichen und Bedeutsamen, und das Gemeine und Unvollkommene mit dem Individuellen und Lokalen. Alles acht Menschliche, alles Bedeutsame im Menschenleben ist nur dann wahrhaft poetisch, wenn es sich in die individuellsten Lagen hinein verzweigt.ie Lieder an Molly z.B. scheinen uns nicht mit Schiller unpoetisch empfunden! Welch eine tief erschütternde, verhängnißvolle Gemüthslage eines Dichters, an eine Gattin gebunden zu sein, die ihm gleichgültig ist, und ihre eigene Schwester unaussprechlich zu lieben und von ihr eben so geliebt zu werden, mit der sich zu verbinden, ihm konventionelle Gesetze nicht gestatten! Gerade durch dieses ganz bestimmte Verhältniß werden uns alle Lieder, die dasselbe offenbaren, interessanter, beziehungsreicher, wahrer und theurer.
[S. 298] Seither ist es hinreichend anerkannt, daß Schiller Bürgern einseitig beurtheilte. In dem Streben nach eigener Selbstveredlung leidenschaftlich begriffen, konnte er einem dem
seinigen ganz unähnlichen Verdienst unmöglich Gerechtigkeit widerfahren lassen. "Bürger's Talent" sagt Goethe, ist ein entschiedenes deutsches Talent, aber ohne Grund und ohne Geschmack, so platt wie sein
Publikum. Schiller hielt ihm freilich den ideell geschliffenen Spiegel schroff entgegen, und in diesem Sinne kann man sich Bürger's annehmen; indessen konnte Schiller dergleichen Gemeinheiten unmöglich neben sich
leiden, da er etwas anderes wollte, was er auch erreicht hat." - Bouterweck fällt folgendes treffende Urtheil: "Schiller wollte Bürger's poetisches Verdienst ganz unbefangen würdigen. Aber es mißlang ihm, weil er seine Idealpoesie der Bürger´schen Naturpoesie zum stetigen Muster vorhielt. Er entdeckte auf diese Art die Schattenseite der Bürger´schen Poesie sehr bestimmt. Alle Fehler und Mängel können nicht stärker und richtiger bezeichnet werden, als in Schiller's Recension, die den armen Bürger so tief verwundete, wie kaum einer der harten Schläge des Schicksals, die um diese Zeit ihn trafen. Die schreiende Ungerechtigkeit dieser Recension beruht auch nicht sowohl auf dem Tadel, in welchem sie wenigstens immer zur Hälfte Recht hat, als auf der Kälte des einseitigen Lobes im Gegensatze mit der Wärme des Tadels. Das war es, was Bürger nicht verschmerzen konnte." Aber Schiller's Geist mußte sich manifestiren, und sich in dem festsetzen, was er später ausübte. Dazu wählte er als Form diese Recension.“
|
|
1838
|
Anonym. Rinaldo und Armida. Archiv für Natur, Kunst, Wissenschaft und Leben. Digitalisiert von Google
“[S. 49] Wiederum wird uns die Freude, unsern Lesern die Copie eines Gemäldes darbieten zu können, das einem der Künstler der Düsseldorfer Schule sein Dasein verdankt. Hildebrand's ´Söhnen Eduard's´ und Lessing's ´Leonore´ reihen wir heute Carl Sohn's ´Rinaldo und Armida´ an. — Sehen wir Hildebrand's künstlerische Genialität durch Shakespeare, die Lessing's durch Bürger, so sehen wir die Sohn's durch den Italiener Torquato Tasso angeregt, und zwar durch dessen episches Meisterwerk ´das befreite Jerusalem.´ “
|
|
1838
|
Bresemann, Friedrich. Die Interjektionen - Bemerkungen und Beispiele.
In: Theoretisch-praktische deutsche Sprachlehre für Dänen. Erster Theil. Kopenhagen. Digitalisiert von Google
“ [S. 410] Die Interjectionen gehören als laute Ausbrüche des Gefühls mehr der Volkssprache, als der Sprache des gebildeten Menschen an; dennoch können sie, am rechten Orte gebraucht,
besonders in der Poesie, oft große Wirkung thun. Man vergleiche z.B. folgende Stellen aus Bürgers Gedichten:
Hui, singt er, hui! Wer macht aus Wind,
Wer sich aus Regen Was?
Nur wehn und wehen kann der Wind,
Und Regen macht nur nass.
Lust am Liebchen.
Und außen, horch! ging's trap, trap, trap!
Als wie von Rosses Hufen;
Und klirrend stieg ein Reiter ab
An des Geländers Stufen.
Und horch! und horch! den Pfortenring
Ganz lose, leise, klinglingling!
Dann kamen durch die Pforte
Vernehmlich diese Worte:
Leonore.
Und hurre, hurre! Hop, hop, hop!
Gings fort in sausendem Galopp,
Dass Ross und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.
Leonore.
Und das Gesindel husch, husch, husch!
Kam hinten nachgeprasselt,
Wie Wirbelwind am Haselbusch
Durch dürre Blätter rasselt.
Leonore.
Ha sieh! ha sieh! im Augenblick,
Huhu! ein grässlich Wunder!
Des Reiters Koller Stück für Stück
Fiel ab, wie mürber Zunder.
Zum Schädel ohne Zopf und Schopf,
Zum nackten Schädel ward sein Kopf,
Sein Körper zum Gerippe
Mit Stundenglas und Hippe.
Leonore.
Heda! Hier nichts gegeckt
Ihr ungewaschnen Buben!
Narriert in andern Stuben,
Nur mich lasst ungeneckt!
Sonst hängt Euch, schnaps! am Munde
Ein Schloss, wiegt tausend Pfunde.
Die Prinzessin Europa.
Da ward das Mägdlein kühn
Und trieb mit ihm viel Possen,
(Das litt er unverdrossen)
Und ach! und stieg auf ihn.
,Hi, hi! ich will's doch wagen,
Ob mich das Thier will tragen?´
Die Prinzessin Europa.
Der streifte durch das ganze Land
Mit Wagen, Ross und Mann,
Und wo er Was zu kapern fand,
Da macht' er frisch sich dran.
Wips! hatt' er's weg, wips! ging er durch
Und schleppt es heim auf seine Burg.
Der Raubgraf.
Drauf ritt der Ritter hop sa sa!
Und strich sein Bärtchen tralala!
Sein Liebchen sah ihn reiten
Und hörte noch von weiten
Sein Lachen ha, ha, ha!
Der Ritter und sein Liebchen.
Hurre, hurre, hurre!
Schnurre, Rädchen, schnurre!
Trille Rädchen lang und fein,
Trills fein ein Fädelein,
Mir zum Busenschleier.
Spinnerlied.
Rüstig, ihr Verwandten meiner Leier,
Satyrbuben, auf! verschont sie nicht!
Alle faulen Äpfel — puh! und Eier
Werft der Bübinn in das Angesicht!
Fortunens Pranger.
Wir herzten, wir drückten, wie innig, wie warm!
Und wiegten uns eia, popeia! im Arm.
Untreue über alles.“
|
|
1838
|
Gervinus, Georg Gottfried. Gesammelte kleine historische Schriften. Karlsruhe. Digitalisiert von Google
“[S. 120] Aber dann müssen Sie mir es schon zu Gute halten, wenn ich mit einigen großen Namen etwas verwegen umspringe. Denn auf der Einen Seite gibt es, wenn ich mit Bürger reden soll,
Ein Ding, das mich verdreußt; der böse Mißbrauch, den man mit der freigebigen Verschwendung des Ehrennamens großer Männer macht; auf der andern hielt ich immer dafür, wirklich große Männer müsse man mehr mit Ernst
und Strenge, als mit Enthusiasmus beurtheilen, wenn einmal die sichere Mitte nicht eingeschlagen werden soll. “
|
|
1838
|
Schilling, Gustav. Die Patienten. In: Sämmtliche Schriften. Neun und sechszigster Band. Dresden und Leipzig. Digitalisiert von Google
“ [S. 45] E. [...]
Freund meiner Seele! lispelte sie nach der stürmischen Umarmung: Ich stehe nun zwischen Tod und Leben und pur durch Ihre Schuld. Denn als wir damals am
zweiten Pfingstabende hinter der Wachsbleiche so traulich im Felde saßen und Sie mir aus den Berger´schen Gedichten das Liedchen vorlasen: ´Ich lauschte mit Molly tief zwischen dem Korn´, und meine geringe Person
seinem Herzblatte verglichen - Ach, es war eine göttliche - eine einzige Stunde!
Zur Sache, Tinchen! unterbrach er sie, denn der angedeutete Stand zwischen Tod und Leben fiel ihm auf's Herz.
S. Nachdem aber deklamirte ich Ihnen zu Liebe ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn´, der im Frühlinge so übel und weh ward und hätte da Jeden einen Lügner und Verleumder gescholten, der mir zu
sagen gewagt: Justinchen, es wird Dir wie der armen Pfarrmamsell gehen!
Ihm lief es bei diesen Worten eiskalt über die Haut. Ich will nicht hoffen! fiel er ein. “
|
|
1838
|
Niederer, Rosette. Nachwort zu Muttergeist und Walten. In: Dramatische Jugendspiele für das weibliche Geschlecht. Erster Theil. Aarau. Digitalisiert von Google
“[S. 201] In der Ballade erscheint die Macht des Schicksals in ihrer Furchtbarkeit. - Sie blitzt von oben herab in dem Wetterstrahl, der trennend und zerstörend in die innigste Harmonie
des Lebens fährt, das Bedürfniß der Versöhnung des Himmels und der Erde in die erschütterte Seele. Wo diese nicht, wie in Bürgers Leonore und in der Thatsache, welche die Romanze schildert, der Verzweiflung
unterliegt, findet sie im Mutterglauben und Muttertreue eine neue Beruhigung, so wie den Anfangspunkt einer neuen höhern Entwicklung, die sich in vollendete Harmonie aller Gegensätze und Widersprüche des Daseins
auflöst.“
|
|
1838
|
Greger, Johann Baptist. Die Eselspartie. In: Ich gedachte Dein! Waltershof im Fichtelgebirg. Digitalisiert von Google
“[S. 85] Jetzt endet die Musik. Auch heute öffnen sich die großen Flügelthüren des Saales und herein tritt ein mittelmäßig bekörperter und bejahrter, gut gekleideter Mann, anständig, ja
man möchte sagen, demüthig. O der Schalk, wie er sich verstellen kann! Herr Gottlieb Willkomm aber bestieg die kleine Bühne und begann mit lächelnder Miene:
Die Eselspartie; oder - der Abt von St. Gallen, von Bürger.
Hier hielt der Deklamator inne, als wolle er erst die tröstenden Seufzer zu einiger Beruhigung entsteigen lassen, und fuhr dann fort: *)
Ich will euch erzählen ein Mährchen, gar schnurrig;
Es war ´mal ein Kaiser, der Kaiser war kurrig;
Auch war ´mal ein Abt, ein gar stattlicher Herr;
Nur Schade! sein Schäfer war klüger als er.
[...]
*) Weil dieses Gedicht immer gerne gelesen oder gehört wird, und man Bürgers Gedichte doch
nicht immer bei der Hand hat, so glaube ich, mir ein Verdienst zu machen, indem ich es hier abdrucken lasse, damit meine verehrlichen Leser, welche dieses schöne Gedicht nicht ganz inne haben, und doch an den
Verlegenheiten unsrer Kurgäste nach billigen Grundsätzen Theil nehmen werden (denn wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie) Gelegenheit haben, auch sich von ihrer Angst befreit zu sehen, und kennen
lernen, daß diese Eselspartie auch nicht die mindeste Anspielung auf jene Eselspartieen im Maxbade an sich trage. “
|
|
1838
|
Stahr, Adolf. Blicke auf die neueste Literatur des Humors / Immermanns Münchhausen. In: Humoristische Blätter, 29. November. Oldenburg. Digitalisiert von Google
“[S. 274] Aber mitgegangen ist er mit der Zeit, der alte Freiherr, das muß man ihm nachsagen. Er hat alle ´Kulturelemente´ unserer Zeit ´in sich aufgenommen,´ und von seinen Mendaciis
ridiculis, die Johann Peter Lange in den Deliciis academicis (welche köstliche Zusammenstellung!) herausgab, und die später der Sänger der ´Frau Schnips´ bei uns einbürgerte, ist wahrlich ein himmelweiter Sprung zu seinen jetzigen Arabesken und Mittheilungen eines verstorbenen Lebendigen. “
|
|
1838
|
Rust, Johann Nepomuk. Die Medicinal-Verfassung Preussens. Berlin. Digitalisiert von Google
“[vor der Einleitung] ´Trost´
´Wenn Dich die Lästerzunge sticht,
So lass Dir dies zum Troste sagen:
Die schlechtesten Früchte sind es nicht,
Woran die Wespen nagen.´
G. A. Bürger “
|
|
1838
|
Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften [...] Sechster Band. Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 61] Rösler (nicht Rößler), Joseph, geboren zu Schemnitz in Ungarn 1773 [...] mehrere deutsche Lieder und Gesänge, darunter die Ballade ´Leonore´ von Bürger.
[S. 312] Sechter, Simon, K. K. Hoforganist in Wien, geboren den 11ten October 1788 [...] mehrere Lieder von Bürger“
|
|
1838
|
Anonym. Mannigfaltiges. In: Magazin für die Literatur des Auslandes. 19. Oktober Berlin. Digitalisiert von Google
“[S. 504] - Bürger's Gedichte vor einem Französischen Gerichtshof.
Die Revue du Nord bringt in einem ihrer neuesten Hefte einen Artikel über ´Bürger's Gedichte´, der,
abgesehen davon, daß er nichts enthält, was sich die Revue nicht aus jedem Handbuche der Deutschen Literatur hätte können übersetzen lassen, ein eigenthümliches Interesse dadurch gewinnt, daß die genannte
Zeitschrift durch richterlichen Ausspruch gezwungen worden, ihn aufzunehmen. Im vorigen Jahre nämlich hatte die Revue du Nord über Bürger und seine Gedichte den ersten Theil einer Arbeit mitgetheilt, deren Verfasser
Herr Emil Haag war. Der letztere nahm es indessen übel, daß ihm die Redaction in seinem Artikel Einiges gestrichen und manche Germanismen in gutes Französisch verwandelt hatte, und deshalb machte er es zur
Bedingung, den zweiten Theil seiner Arbeit ohne die geringste Veränderung abdrucken zu lassen. Da sich die Redaction hierzu nicht verstehen wollte, so reichte er eine Klage bei der fünften Kammer des Civil-Tribunals
von Paris ein, und diese verurtheilte die Redaction der Revue du Nord, die prosaische Uebersetzung von acht Gedichten Bürger's, so wie den Kommentar dazu, wie sie von Herrn Emil Haag geliefert worden waren,
unverändert aufzunehmen. Die Revue hat sich nun dadurch gerächt, daß sie die stylistischen Ungeschicklichkeiten des Aufsatzes und namentlich die Germanismen in der Uebersetzung durch gesperrte Schrift hervorhob und
dergestalt von dem Urtheil der fünften Kammer an das des Publikums appellirte. So hart dieses Verfahren unseren Landsmann auch trifft, so können wir darin doch nur die wohlverdiente Bestrafung einer ungemessenen
schriftstellerischen Eitelkeit wahrnehmen. Auch ist uns Herr Emil Haag schon aus früherer Zeit dadurch bekannt, daß er in der Revue Germanique, als eigene Arbeit, einen Artikel über die Polnische Literatur abdrucken
ließ, der fast wörtlich aus dem Brockhausischen Conversations-Lexikon nach der Arbeit eines Anderen übersetzt war. Durch solche schriftstellerische Thätigkeit kann der Ruf der Deutschen Literatur in Frankreich
allerdings nicht sehr gehoben werden.“
|
|
1838
|
Allerlei. In: Der Bayerische Eilbote. München 11. December. Digitalisiert von Google
“[S. 596] Scribe ist ein Glückskind! Nicht genug, daß die halbe Welt in seinen Stücken lacht, allen Kritikern, die sie belachen, zum Trotz, schickt ihm nun gar eine vornehme walachische Dame ihr Porträt mit Diamanten. Was ist Bürgers Schwabenmädchen (abgesehen davon, daß sie den Sänger der Leonore nachher so unglücklich machte) mit ihrem Gedichte gegen diese porträtirte Dame aus der Walachei! “
|
|
1838
|
Rez. Zwölf Balladen und Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte, von J. A. Lecerf. In: Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig. Digitalisiert von Google
“ [Sp. 493] 4) Trautel, von Bürger; des Dichters Weise ist in Tönen so vollsinnig und lieblich gesungen, dass es seltsam wäre,wenn es nicht Jedem wohlgefiele.“
|
|
1838
|
Hawkins, Bisset. Modern German Literature. In: Germany; the Spirit of her History, [...] London. Digitalisiert von Google
“[S. 104] Herder and Buerger are both fond of characterising Homer as the poet of the people; but the fact is, that the Greek singers of his age practised their art not in public, but
in the halls and palaces of princes, and it was not till the decline of Greece that their voices were heard in the streets. Let it not to be supposed, however, that we undervalue the meritorious exertions of Herder
and Buerger in the field of popular poetry; the former discovered the treasures of by-gone ages, and the latter coined them anew for the enjoyment of the present.
Buerger’s ballads, and particularly
his ´Leonora,´ and ´The Wild Huntsman,´ are amongst the most splendid productions of which German literature can boast. Nor can we, whilst admiring his works, omit to commemorate the amiable character of the
unfortunate Buerger. Although his poems, precious as they are, still want the high worth of their ancient models, yet he little merited the severe attacks of Schiller, whose lofty rhetoric imposed on and wounded
him, and was yet, in fact, beneath his notice *.
*blackwoods edinburgh magazine “
|
|
1838
|
Anonym. Erste Vorstellung der lebenden Bilder im Theater. In: Süddeutsche Blätter für Leben, Wissenschaft und Kunst, 8. Febr. Nürnberg. Digitalisiert von Google
“[S. 64] Der Albrecht-Dürers-Verein gab am letzten Sonnabend zum Besten des Albrecht-Dürers-Denkmal und der hiesigen Armen mimisch-plastische Vorstellungen in 3 Abtheilungen. Da es der
Zweck des Vereins ist, die Kunst mit dem Leben zu verbinden und alles aufzubieten, was dazu beitragen kann, den Künstler anzuregen, und in den Mitgliedern die Liebe zur künstlerischen Darstellung zu fordern, so
waren jene Bilder eine passende Wahl, abgesehen, daß auch die Bestimmung der Einnahme ebenso den Verein, wie die zahlreiche Theilnahme das Publikum ehrte. Die sogenannten lebenden Bilder sind ein vermittelnder
Uebergang vom Drama zur Plastik und Malerei; dort stellt der Dichter den Charakter in seiner fortlaufenden Entwicklung durch eine Reihe von Handlungen bis zur Katastrophe dar, hier fucht der Künstler Einen Moment,
wo Person und Handlung eine gleich interessante Anschauung darbieten, heraus und stellt ihn in malerischer Situation und Ruhe dar. [...] Daß es aber überhaupt nicht auf das Massenhafte der Darstellung ankommt, beweisen diejenigen Bilder, welche wenig Figuren zeigten, wo aber in die Handlung oder in die Person etwas gelegt war, das in einer stummen empfindungsreichen Sprache alle Herzen bewegte; so Belisar nach Gerard, gestellt von Herrn Geißler jun. und Bürger's Lenore, gestellt von Herrn Direktor Heideloff. “
|
|
1838
|
Seelig, August. Theater Nachricht. In: Süddeutsche Blätter für Leben, Wissenschaft und Kunst, 10. März. Nürnberg. Digitalisiert von Google
“[S. 116] Montag, den 12. März. Zum Vortheil des Unterzeichneten: ´Lenore.´ Schauspiel mit Gesang in drei Aufzügen von C. v. Holtei. Musik von E. Eberwein.
Dem. Belleville vom Hoftheater zu Coburg hat aus besonderer Gefälligkeit die Rolle der Lenore übernommen. Das ausgeführte Mantellied als Quartett wirb von den Herren Seyfarth, Weitgaß, Huppmann und Ball,
Letzterer als Wallheim, ausgeführt.Zu dieser Vorstellung ladet ganz ergebenst ein
August Seelig,
Mitglied der hiesigen Bühne. “
|
|
1838
|
Anonym. Correspondenz-Artikel - Stuttgart, den 26. Mai 1838. In: Süddeutsche Blätter für Leben, Wissenschaft und Kunst, 2. Juni Nürnberg. Digitalisiert von Google
“[S. 255] An demselben Abende, welcher dieses Fest verherrlichte, ging Holtei's ´Lenore´ zum ersten Male über unsere Bühne. Ich traute kaum meinen Augen, als ich die Ankündigung las. Dieses Stück hat übrigens auch hier wie anderwärts allgemeinen Beifall gefunden.“
|
|
1838
|
Anonym. [Rez.] Medizinische Gymnastik von J. A. L. Werner. In: Allgemeine Schulzeitung, 25. October Darmstadt. Digitalisiert von Google
“[Sp. 1374] Lavater bekam so manchen Gegner und wurde hier und dort bespöttelt, ohne daß seinem Werthe und ruhmvollen Bestreben ein Abbruch geschah. Auch der thätige Werner hat so
Manches hier und dort von Böswilligen oder Unverständigen erdulden müssen; allein dieses beeinträchtigt seine Bemühungen und sein redliches Wirken keineswegs, und Werner kann das, was Bürger wegen Lavater sagte, auf
sich anwenden:
Wenn dich des Neides Zunge sticht,
So laß dir dieß zum Troste sagen:
Die schlecht'sten Früchte sind es nicht,
Woran die Wespen nagen.“
|
|
1838
|
Anonym. Rez. F. G. Wetzels gesammelte Gedichte und Nachlaß. In: Literaturblatt, 17. August. Stuttgart und Tübingen. Digitalisiert von Google
“[S. 329] Ueberall verräth sich des Dichters offner Charakter, daher ein vertraulicher Ton durch alle seine Gesänge durchklingt, ungefähr wie der Ton Bürgers, nur daß er nie so derb
wird. Daraus geht aber auch eine gewisse Bequemlichkeit hervor, die den Dichter vom sorgfältigeren Feilen seiner Gedichte abgehalten zu haben scheint. “
|
|
1838
|
Hofmann, Friedrich. Die Schlacht bei Focksan, Schauspiel in fünf Aufzügen. Jena. Digitalisiert von Google
“[S. 84] Martchen.
Mein liebes, gnädiges Fräulein, ich glaube gar, Sie weinen noch um Ihre hochselige Mutter. Sie ist ja schon zwölf Jahre todt. Ach, da dürften meine
Augen gar nicht trocken werden: meine Mutter liegt erst vier Jahre im Grabe und mein Vater steht mit einem Fuß darüber. Man muß die Todten im Grabe ruhen lassen, sonst stehen sie auf und holen einem nach. Kennen Sie
die ´Lenore fuhr um's Morgenroth´ nicht?
Anna.
Nein.
Martchen.
Sie ist ganz neu, mein Chris— der Herr Kammerdiener beim Prinzen hat sie uns aus Deutschland mitgebracht. Soll ich sie erzählen? Anna (setzt sich auf die entgegengesetzte Seite auf einen Stuhl).
Ja.
Martchen.
Es war einmal ein Mädchen, die hieß Lenore und die hatte einen Schatz, und der hieß Christoph — nein — Wilhelm — und der hieß Wilhelm. Und der Schatz war
ein schwarzer Husar und zog mit dem alten Fritz in den siebenjährigen Krieg gen Böhmen und ward erschossen. Und als der Krieg aus war und die Soldaten nach Hause marschirten, kam er nicht mit, denn er lag in einem
Grabe in Böhmen. Aber das Mädchen weinte Tag und Nacht und zürnte mit dem lieben Gott und weinte so lange, bis ihr Schatz im Grab erwachte. Und wie sie einmal Nachts wieder weinte, schlug es Zwölfe und ein Reiter
kam und klingelte und Lenore glaubte, es sey ihr lebendiger Schatz und setzte sich mit auf sein Pferd —
´Und hurre, hurre, hopp hopp hopp
Ging's fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben
Und Kies und Funken stoben!´
Und der Mond schien und die Todten ritten
schnell. Und endlich ritt er in einen Gottesacker hinein. Darin tanzten die Geister auf ihren Gräbern und sangen Todtenlieder dazu. Und auf einmal versanken das Roß und der Reiter und die Lenore tief, tief, tief in
ein Grab — es schlug Eins!
(Martchen hat während der letzten Worte sich mit dem Stuhl unwillkürlich vorgebogen, ihre Körperbewegung bei ´Eins!´ läßt
den Stuhl zurückfallen, worüber beide Mädchen heftig zusammenschrecken.)
Mein Gott, bin ich doch fast erschrocken. “
|
|
1838
|
Lyser, Johann Peter. Frau Wode. In: Abendländische Tausend und eine Nacht. V. Bändchen. Meissen. Digitalisiert von Google
“[S. 81] Wenn die Mächen aber recht fleißig spinnend des Abends beisammen sitzen, dann geschieht es oft, daß es draußen vor der
Thüre ´klipp, klapp! klipp, klapp! geht, grade, als
käme eine Frau auf Pantoffeln die Stiege herauf —, nicht lange darnach tritt denn auch wirklich Frau Wode mit einem Spinnrocken zur Thür hinein, setzt sich mitten unter die Mädchen und fängt an zu spinnen, und hat
es dann gerne, wenn die Mädchen ein altes Spinnerliedchen singen, welches also heißt:
Hurre, hurre, hurre!
Schnurre Rädchen! schnurre!
Leere Spindel , dreh' Dich fein!
Mädchen müssen fleißig seyn.
Hurre, hurre, hurre!
Hurre, hurre, hurre:
Schnurre Rädchen! schnurre.'
Weber, webe zart und fein,
Webe mir ein Tüchelein,
Zu der Kirmißfeier.
Hurre, hurre, hurre!
Schnurre Rädchen! schnurre!
Außen blank und innen rein,
Muß des Mädchens Anzug seyn,
Das lockt wackre Freier.
Hurre, hurre, hurre!
Wenn dann die Frau Wode eine Stunde mitgesponnen hat, dann steht
sie auf und besieht das Gespinnst der Mädchen, und die, welche am fleißigsten und feinsten gesponnen hat, bekommt gewöhnlich um Weihnachten einen gehenkelten Dukaten von ihr zum Geschenk, und solch ein Dukaten
bringt großes Glück und macht die Mädchen bald reich - sie müssen aber immer fleißig und fromm bleiben, denn sonst verschwindet der Dukaten. “
|
|
1838
|
Anonym. Das aristophanische Lustspiel und unsere Zeit. In: Die Verklärung der Liebe oder die Nachteulen, Erlangen. Digitalisiert von
Google
“[S. VII] Die teutsche Poesie mußte noch lange fühlen, daß sie eigentlich von der Vornehmheit nur geduldet wurde. Wie bescheiden und harmlos tritt nun der
Witz auf. Rabener, Gleim, Gellert, wagten nur ganz allgemeine Zustände der menschlichen Gesellschaft zu berühren, und dennoch hatten sie manchen Verdruß. Welch gewaltigen Lärm erregten aber ein paar Xenien! Die
guten Leute glaubten schon durch sie den Anstand verletzt.
Bald aber sollte es anders werden. Männer wie Lessing, Bürger etc. konnten zwar in einer sehr demüthigen Stellung bleiben und von den
Parforcejägern und ihren Gesellen ignorirt werden, jedoch in das Herz der Nation brachen sie sich kräftig Bahn. Ueberall regten sich die Geister gewaltig unter dem erdrückenden Felsen der Convenienz.”
|
|
1838
|
Wertheimer, Joseph. Eheliches Leben. In: Dramatische Beyträge, Wien. Digitalisiert von Google
“[S. 250] Mistriß Belfort.
Ach, das ist's ja eben; er ging heute schon vor meinen Fenstern vorüber, blickte hinauf zu mir, ach, ach! (Sie schluchzt.)
Mistriß Coddle.
Nun, was wollen Sie denn mehr?
Mistriß Belfort.
Hören Sie nur, als er nun hinaufblickte, und ich so ganz verstohlen hinab, da fiel mir die deutsche Ballade ein:
´Blandine sah her, Lenardo sah hin,´ - und das rührte mich so, daß ich mich gleich wegwenden mußte. Das hat er nun vielleicht übel ausgelegt, denn als ich wieder hinblickte, da war er nicht mehr zu sehen, ach! -”
|
|
1838
|
Anonym. Staudinger. In: Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, Hg. Gustav Schilling, Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 472] Staudinger, Johann Georg, Componist und zu seiner Zeit guter Clavierspieler, war Cantor und Musikdirector zu Weißenburg am Nordgau, und starb daselbst um 1790. Von seinen
Tondichtungen sind noch vorhanden: die Operetten ´die Lyranten,´ ´der Dorfjahrmarkt´ und ´die Wahl des Herkules;´ die Melodramen ´Polyxena´ und ´Lenardo und Blandine,´ Arien zu ´Faust,´ Ouverture zu ´Arno,´ und
mehrere kleinere Sachen für Clavier und andere Instrumente.”
|
|
1838
|
H. Die todte Braut. In: Oesterreichisches Morgenblatt, 27. Jänner, Wien. Digitalisiert von Google
“[S. 46] Und es ward Licht! das schönste Morgenlicht am - Dienstage, für mich der liebenswürdigste Schöpfungstag.
Ich fuhr empor ums Morgenroth
Empor aus schweren Träumen -
weckte Adolph, als sollte er, bevor noch die Hähne ihr allerliebstes Morgenlied ausgekräht, zur Baronin Clarisson gehen.”
|
|
1838
|
Anonym. Versicherungsanstalten. In: Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der Deutschen (Allgemeiner Anzeiger der Deutschen), 27.11.
“Ein Paar Worte zur Würdigung der schon früher und neuerdings wiederholt gegen die Feuerversicherungsbank f. D. zu Gotha gerichteten Angriffe und Beschuldigungen.
Wenn dich die Lästerzunge sticht,
So laß dir dieß zum Troste sagen:
Die schlecht'sten Früchte sind es nicht,
Woran die Wespen nagen.
Bürger.
Die Feuerversicherungsbank für Deutschland zu Gotha, welche bey ihrer Eröffnung (1. Januar 1829) zuerst
unter der Firma [...].”
|
|
1838
|
Fremdenliste. In: Der Eilbote, 08.12.
“Es war zwar ein Mann zur Ueberwachung während des Transportes eigens bestellt, dieser legte sich aber, sich
höheren Betrachtungen nachgebend, in das Innere des Wagens und schlief ein. Hier sitz ich und stehe Schildwache! Hat dieser Dampfwagen einmal Danpf, dann geht's an. Landau wird die erste Stadt der Pfalz seyn, welche
den Dampf los läßt, Rund weiter, weiter, hop, hop, hop!
Gings fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben
Und Kieß und Funken stoben! “
|
|
1838
|
Anonym. Neueste Welthändel. Oesterreich. In: Regensburger Zeitung, 27.07.
“Wenn es überhaupt nicht eben die
schlechtesten Früchte sind, an denen die Wespen nagen, so kann sich die Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft über ähnliche, fast möchte man glauben, böswillig ausgestreute, aber in sich selbst zerfallende Gerüchte mit
Beruhigung hinwegsetzen; [...].”
|
|
1838
|
Deutsche Bilder. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, 15. May
“Kunst hatte das
Eisen nicht zu Stahlfedern verarbeitet; das genirte indessen die jungen Leute nicht im geringsten, ihre Lederhosen schienen mit ihren Sätteln ein unauflösliches Bündniß geschlossen zu haben, denn obgleich ihr Rennen
die solideste Versinnlichung von Bürger's ´Hopp, hopp, hopp!´ die sich denken läßt, war, so wich und wankte doch keiner.”
|
|
1838
|
Ellwangen. (Theater-Anzeige.) In: Allgemeines Amts- und Intelligenz-Blatt für den Jaxt-Kreis, 14.11.
“Freitag den 16. dieses Monats:
Leonore, die Braut des Todes.
Grosses historisches Schauspiel mit Gesang und Melodram nach Bürger's ´Leonore´, bearbeitet von Holtey, Musik von Eberwein.
Hiezu ladet ergebenst ein
Strasser, Direktor.”
|
|
1838
|
Bury, Charlotte Susan M. The Murdered Queen! or Caroline of Brunswick[-Wolfenbüttel]. A Diary of the court of George IV. London
"[S.
41] I cannot tell you ma chere Palmyre, all the pleasure I have received from a visit to the Princess of Wales, at Charlton [1800]. In her, all the virtues of her sex seem concentrated—and indeed, rendered more
brilliant by the dark clouds of the destiny which has awaited her! Music, painting, embroidery, modelling in clay, floriculture, and reading, fill up the leisure which attendance on her little daughter permits; and
the affection of the latter, as it is displayed in every act, word, and look, presents one of the most charming pictures in the world. The Princess raises a great quantity of vegetables, which are given to the poor;
but indeed her alms of every kind are most munificent. She has very few visitors:—nor does she want them. Her taste in clay-modelling is really astonishing :—a group from Burger's 'Leonora;' and her portrait of her
daughter are exquisite: and she has also executed a table in imitation of mosaic, quite a chef d'oeuvre. She has a mind teeming with new and original ideas; her conversation is so vivacious, that it is not easy at
all times to follow her; and the play of her eye so dazzling, that once seen, it is imprinted lastingly on the memory."
|
|
1839
|
Anonym. Sechter, Simon. In: Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, Sechster Band, Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 311] Sechter,
Simon. K.K. Hoforganist in Wien, geboren den 11ten October 1788 zu Friedberg in Böhmen, erhielt erst im 11ten Lebensjahre von dem dortigen Regenschori, Johann Maxandt, einigen musikalischen Vor-Unterricht, und fing
darauf selbst zu componiren an; jedoch blos nach dem Gedächnisse. [...] Nur der kleinste Theil seiner ungemein zahlreichen Werke ist durch den Druck verbreitet; sehr werthvolle derselben hat Nägeli veröffentlicht
und durch sein Kennerurtheil nach Verdienst gewürdigt. Er selbst dürfte wohl schwerlich im Stande seyn, einen vollständigen Catalog seiner Werke zu entwerfen; was er jedoch, außer den Jugendversuchen, in
chronologischer Reihenfolge seit dem Jahre 1806 eigenhändig verzeichnete, besteht in Folgendem: 1 komisches Sextett ´il Confuso;´ Ouverture in C; ´die Erfindung des Kusses,´ Ged. von Schlegel; 3 Clavierstücke; ´das
Lied von der Glocke;´ 1 zweichörige Vocal-Messe; mehrere Lieder von Bürger: [...].”
|
|
1839
|
Kfm. [Rez.] Abálard und Heloise. Ein Cyclus epischer Dichtungen. In: Zeitung für die elegante Welt. Digitalisiert von Google
“ [S. 215] Vielleicht aber wollte der Verf. auf indirecte Weise an Pope's Heroide: Heloise an Abálard erinnern, die Bürger nicht nur ins Deutsche, sondern in glühendere, südlichere Poesie übertrug. Das wäre aller Ehren werth. Solche Erinnerungen an verkannte Geister, wie Bürger u. A. thäten zuweilen dem undankbaren Gedächtnis der Deutschen noth.“
|
|
1839
|
Mahlmann, August. An Bürgers Grabe. In: August Mahlmanns sämmtliche Schriften. Erster Band. Leipzig,
“[S. 17] An Bürgers Grabe.
Dir gab Apoll die Laute,
Gab dir den freien Sinn,
Und jeder Deutsche schaute
Auf seinen Dichter hin.
Und fröhlich, aller Orten,
Sang man dein Lied dir nach,
Das, wie mit Zauberworten,
Zu jedem Herzen sprach.
Doch du bliebst ohne Freuden,
Der so viel Freuden bot,
Und deiner Lyra Saiten
Verstimmten Sorg' und Noth!
Den mit der schönsten Gabe
Die Götter reich beschenkt,
Der ging zu seinem Grabe,
Von Menschen tief gekränkt!
Vergiß die Welt voll Mängel
Hier unter diesem Stein!
Dort stimmt ein guter Engel
Die Lyra wieder rein! “
|
|
1839
|
Anonym. Notizen. Münchhausen. In: Zeitung für die elegante Welt, Leipzig. Digitalisiert von Google
“ [S. 212] Mit lebhaftem Verlangen erwartet man im Publicum die Fortsetzung des Immermann´schen Romans. Mancher holt voll Ungeduld das alte Volksbuch wieder hervor. Dies alte
Buch von den Abenteuern des Herrn von Münchhausen haben Viele gelesen. Wenige aber mögen wissen, daß es nach englischen Vorbildern, wahrscheinlich von Niemand anderes als von Gottfried August Bürger ausgearbeitet
wurde. Es lebte zu jener Zeit ein Herr von Münchhausen in Hannover, der fingirte Erzählungen sehr liebenswürdig mitzutheilen wußte.“
|
|
1839
|
Laube, Heinrich. Geschichte der deutschen Literatur. Zweiter Band.
“[S. 181] Gottfried August Bürger - 1748 - 1794, das Haupttalent, welches die Göttinger Bestrebung zur größten Popularität erhob, hat leider ein herumgeschlagenes, störsames Leben
geführt, ist vor eitel Sorge für das Gemeine und Nothdürftige selten zu der beseligenden Dichterruhe gekommen, und hat darum in sich selbst niemals das Ziel einer reifen, umrundeten Bildung erreicht, welches die
Grundlage wird für alles höchste Kunstwerk. Dieser Uebelstand war wohl auch der Grundgedanke jener vielbesprochenen Schiller´schen Recension, welche Bürger so tief in´s Herze traf. Schiller kleidete dies in
philosophische Forderungen, sprach von jenem Idealismus, der ihn selbst erfüllte, und welcher alles Popular-Talent nur zu würdigen wußte, wenn es in seine eigene ideale Forderung veredelt werde, daß Bürgers Glück
und Liebe nichts anderes als das eben zunächst liegende Glück, die zunächst liegende Liebe, aber nicht das Ideal von Glück und Liebe sei; - er that Bürger Gewalt an, schematisirte einen Volksdichter, der in der
nächsten Literatur gar nicht vorhanden war, nach abstrakten Begriffen, wie sie nun eben sein Dichtergenius, ein ganz anderer, besaß. So schlug er das Schlechte und das Gute in Bürger mit einem Streiche, weil eben
Gutes in Bürger war, wofür Schiller keine Auffassung hatte; er tadelte Bürgers unmittelbares Ergreifen des Stoffes, das Ergreifen ohne Vermittlung der Reflexion, was just der Stempel des Genies in Bürger war, er
tadelte dessen kräftige Refrains, die musikalischen Begleitungsworte der Balladen, wodurch die Bürger´sche Ballade so nachdrücklich in ihren ächten Bereich, in den Bereich des Gesanges hinein gehoben wurde, - kurz,
er that ihm Unrecht. Wenigstens in der Begründung des Vorwurfs.
Hinter dieser Begründung hatte Schiller freilich großes Recht, und wenn es nackt gesagt worden wäre, so hätten Bürgers Balladen
wahrscheinlich dabei gewonnen, aber der Schlag wäre zerschmetternd auf Bürger selbst gestürzt. Bürger selbst, sein Leben, sein Charakter war gemeint; - es ist gleichgültig, ob sich Schiller dessen bewußt gewesen,
denn es ist Alles gegeben, um es so anzusehen.
[S. 183] Diesen Rost meinte Schiller, und verwarf deshalb die ganze Eisenklinge, die einem Volksdichter nöthig ist; denn die schimmernd stählerne eines
Paradedegens hätte bei Bürgers großem Publikum keine Anerkennung gefunden. Heine erschöpft die Frage durch eine einzige Bezeichnung, er sagte den Franzosen: Bürger war das, was Ihr einen citoyen nennt.
[S.
185] Seine vollendeten farbigen Balladen, deren Verdienst nicht entkräftet wird, wenn man ihnen die englischen Vorbilder vorhält, sind ein Ereigniß in unserer Literatur.”
Laubes Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1839
|
Conversations-Lexicon Band 2 von Allgemeines deutsches Conversations-Lexicon für die Gebildeten eines jeden Standes:
Mit den gleichbedeutenden Benennungen der Artikel in der lateinischen, französischen, englischen und italienischen Sprache, nebst der deutschen Aussprache der Fremdwörter 1839. Digitalisiert von Google
“[S. 415] War gleich B.´s moralischer Charakter nicht ganz fleckenlos, so sank er doch nie zur Gemeinheit herab. Güte des Herzens, Anspruchslosigkeit, Rechtlichkeit wiegen seine
Fehler, welche er ohnehin bitter genug entgelten mußte, bei weitem auf. - Seine Gedichte leben größtentheils in dem Munde des deutschen Volkes und werden so lange darin leben, als Wahrheit und Natürlichkeit der
Empfindungen nicht von ihm gewichen sind. Am höchsten stehen B.´s Romanzen; mimische Lebendigkeit und Fülle der Gedanken zeichnen sie durchgehend aus. Das eifrige Studium altenglischer Balladen hatte ihm in dieser
Gattung den wahren Weg gezeigt. Seine "Leonore" wäre allein hinreichend, ihm die Unsterblichkeit zu sichern. Auch im Liede, in der Ode, Elegie, poetischen Erzählung und im Epigramme versuchte sich B. mit
dem größten Glücke. An Pracht und Fülle der Sprache kommt ihm kein Dichter seiner Zeit gleich. Das Sonett ward von ihm wieder zu Ehren gebracht und es gelang ihm meisterhaft; nur in scherzenden Gedichten war er
unglücklich und er fiel zu leicht ins Derbe und Rohe, was freilich auch, wenigstens größten Theils, seinen individuellen stets ungünstigen Verhältnissen und dem genial sein sollenden Streben seiner Zeit angerechnet
werden muß. Schiller faßte diese Schattenseite seiner Gedichte allzustreng auf und sprach ihm geradezu die Kunst zu idealisiren ab;[...] “
|
|
1839
|
Anonym. Allgemeine musikalische Zeitung. Band 41. Februar, No. 9. Digitalisiert von Google.
“[S. 180] L. Niedermeyer in Paris hat eine, nach Bürger bearbeitete Ballade "La noce de la Léonor" von E. Deschamps in Musik gesetzt; sie gefällt, wie alle Kompositionen
dieses Mannes, in Paris sehr. - Ueberhaupt sind die Romanzen, Balladen und Chansonetten dort an der Tagesordnung, dutzendweise kommen sie heraus, und es ist allerdings nicht zu leugnen, dass sich gerade in dieser
Form die eigenthümlichen Vorzüge der französischen Musik ins hellste Licht stellen lassen."
|
|
1839
|
Anonym. Notizen. Retzsch´s Umrisse zu Bürger Balladen. In: Zeitung für die elegante Welt, Leipzig. Digitalisiert von Google
“ [S. 784] Man kennt das berühmte Blatt von Retzsch, die Schachspieler; fast eben so bekannt, wenn auch weniger den Anforderungen der Kritik genügend, sind seine Umrisse zu Hamlet,
Macbeth, Romeo und Lear einige davon erlebten sogar in London und Leipzig eine zweite Auflage. Jetzt erschien auch bei Ernst Fleischer ein Heft zu Bürger's Balladen, in 15 Blättern zu Leonore, zum Lied vom braven
Mann und des Pfarrers Tochter von Taubenhain, vom Hrn. v. Miltitz in Dresden, der als Cicerone des alten Bötticher Nachfolger wurde. Auch in England, wo Bürger's Balladen durch vielfache Bearbeitungen sehr
bekannt geworden, werden die Blätter sich vielen Eingang verschaffen.“
|
|
1839
|
Anonym. Religionsschwärmerei und Mysticismus. In: Die Fackel. Literaturblatt zur Förderung geistiger Freiheit. Saint Paul, Minnesota. Digitalisiert von Google
“[S. 143] Unter Gebet kann ich mir nichts anders denken als einen Durchbruch der Empfindungen von Gott und seiner Güte, das da wo das Herz spricht mit einem O Gott! am natürlichsten
abgethan ist (es ist ungefähr wie das Lautreden in der Einsamkeit), folglich erscheinen lange Gebete als reine gedankenlose Formeln. Gott gab uns so Vieles, daß wir ihm billig mit so vielen Bitten verschonen
sollten, und in gewissen Umständen ist das Gebet sogar unmöglich und das Angstgebet vollends eine wahre Impertinenz. Die Mutter von Bürgers Leonore sagt zwar:
Hilf, Gott, hilf! setz' uns gnädig an,
Kind, bet' ein Vater Unser
Was Gott thut. das ist wohl gethan,
Gott! Gott! erbarmt sich unser!
Leonore meint aber:
O Mutter ! Mutter! was mich brennt
Das lindert mir kein Sakrament,
Kein Sakrament mag Leben
Den Todten wieder geben.
Jener Pastor betete bei jeder
guten Zeitungspost mit Simeon : ´Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,´ jedoch stets mit dem bedächtigen Beisatz: ´Wenn Zeit und Stunde gekommen ist.´ Er scheint mehr dabei gedacht zu haben, als
jener achtzigjährige Fürst bei seinem Morgensegen : ´O Herr, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage,´ (wobei der Erbprinz natürlich saure Gesichter schnitt) oder jener Reichsgraf, der zu Hamburg in die Elbe
fiel und in der Angst betete: ´Komm, Herr Jesus, sei unser Gast!´ “
|
|
1839
|
Caspers. Rez. Abhandlungen über die allgemeinen Eigenschaften des deutschen Stils für Gymnasien von Clemens Siemers. Münster 1839. In: Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik.
Sechs und zwanzigster Band. Erstes Heft. Leipzig 1839. Digitalisiert von Google
“[S. 140] Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass der Unterricht in der deutschen Sprache als nothwendiges und einflussreiches Bildungsmittel in den Gymnasien endlich anerkannt und
behandelt wird, da derselbe sonst mehr oder minder vernachlässiget wurde. Das dringende Bedürfniss zweckmässiger Lehrbücher für die verschiedenen Zweige dieses Unterrichtes sucht man daher immer mehr zu befriedigen.
Unter diesen zeichnet sich G . A. Bürgers Handbuch des deutschen Stiles, herausgegeben von Karl von Reinhard. Berlin bei Schüppel 1826. als ein Hülfsmittel für Lehrer ganz besonders aus. Die vorliegende Abhandlung ist ein Auszug aus diesem Werke, zum Gebrauche der Gymnasialschüler bearbeitet, aber kein selbstständiges Werk, als welches dieselbe auftritt. Es ist zu bedauern, dass der Hr. Verf. dieses nicht gesagt hat, da er dadurch den Schein vermieden hätte, als wolle er Fremdes für Eigenes ausgeben. In den Folgenden wird Ref. die Identität mit dem Bürgerschen Werke nachweisen, und was Hr. S. ans dem Seinigen hinzugethan hat, gewissenhaft aussondern.
[S. 146] Ref. glaubt, bisher sattsam gezeigt zu haben, wie der Hr. Verf. B.s Lehrb. benutzt hat; daher bricht er hier ab; da in den noch übrigen § § sich dieselbe Unselbstständigkeit zeigt. Möchte der Hr. Verf. auch die Aufrichtigkeit Bürger's,
mit welcher dieser überall seine Quellen nennt, nachgeahmet haben! Diese Abhandlung erinnert an die Behauptung Ciceros von Epikur de fin. bon. et mal. I. 6. 21: Ita, quae mutat, ea corrumpit: quae
sequitur, sunt tota Democriti.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass es bedenklich ist, diese Abhandlung in dieser Gestalt in die Gymnasien einzuführen, weil das Werk von Bürger den Schülern leicht zu Gesichte kommen kann. Wenn sie als Auszug aus diesem Werke erscheint, die darin vorkommenden Irrthümer berichtigt sind, für Vollständigkeit und einen bessern Ausdruck gesorgt ist, so wird sie ihren Zweck nicht verfehlen, indem sie für den Schüler ein Leitfaden sein wird, woran er dem Vortrage des Lehrers folgend sich vorbereiten und wiederholen kann. “
|
|
1839
|
Seume, Johann Gottfried. Venedig. In: J. G. Seume´s sämmtliche Werke. Erster Band. Leipzig. Digitalisiert von Google
“ [S. 232] Am Thore zu Udine stand eine östreichische Wache, die mich examinirte. Ich bat um einen Grenadier, der mich in ein gutes Wirthshaus bringen sollte. Gewährt. Aber ein gutes
Wirthshaus war nicht zu finden. Ueberall, wo ich hineintrat, saßen, standen und lagen eine Menge gemeiner Kerle bacchantisch vor ungeheuer großen Weinfässern, als ob sie mit Bürger bei Ja und Nein vor dem Zapfen
sterben wollten. Es kam mir vor, als ob Bürger hier seine Uebersetzung gemacht haben müsse; denn der lateinische Text des alten englischen Bischofs hat dieses Bild nicht.“
|
|
1839
|
Schrön. Es giebt drei Heilprincipe (Rez.). In: Hygea, Zeitschrift besonders für specifische Heilkunst. X. Band. Carlsruhe. Digitalisiert von Google
“[S. 547] Bei dem Grossen, das Dr. Helbig in Bezug auf das ´Aehnlich´ zu leisten vermag, wundere ich mich, dass er seinen Vordersatz nicht bestimmter ausgesprochen, denn wer gut und
böse zu sich ähnlichen Begriffen, Feuer und Wasser, Säure und Base zu sich ähnlichen Dingen machen kann (pg. 83), ´hat sicher aus Häckerling Gold´, oder auch aus Gold Häckerling schon gemacht, und findet gewiss in
der Wirkungssphäre oder in der Naturgeschichte eines jeden Mittels Aehnlichkeiten mit Zuständen, welche nach irgend einem Heilprincipe mit dem Mittel gemacht worden sind. “
|
|
1839
|
Anonym. X. Monatsbericht. In: Journal für rationelle Politik. Hamburg. Digitalisiert von Google
“[S. 93] In Hessen-Darmstadt ward auch eine Interpellation zu Gunsten des Rechtszustandes in Deutschland bei der Kammer der Abgeordneten vorbereitet; es wird aber beim Vertrauen in
die Regierung bleiben. Von Hannover aus heisst es, dass dies Alles leeres Stroh dreschen heisst, oder wie Bürger sagt: ´hin ist hin, verloren ist verloren.´ “
|
|
1839
|
Redaktion der Bohemia. Abfertigung. In: Bohemia 2. April. Prag Digitalisiert von Google
“[o.S.] Herr Saphir möge daher irgend ein Lehrbuch der deutschen Prosodie durchlesen, es wird nicht ohne Nutzen für ihn seyn. Auch das Metrum findet
Herr Saphir sonderbar und neu. Wenn Herr Saphir vielleicht einmal Bürgers Gedichte gelesen hat, so wird er ersehen haben, daß schon Bürger nicht bloß in Jamben gedichtet hat, wie z. B.
Das leugst Du, Plump von Pommerland,
Bei Gott und Ritterehre!
Herab! herab! daß Schwert und Hand
Dich and're Sitte lehre.
Halt, Trudchen, halt den Dänen an!
Herunter, Junker Grobian,
Herunter von der Mähre,
Daß ich Dich Sitte lehre!
sondern auch
in Amphibrachen, z. B. Lenardo und Blandine, der Kaiser und der Abt, die Kuh usww. Aber auch die Koryphäen der deutschen Dichtkunst, Schiller und Göthe, haben sich dieses, nach Herrn Saphir fehlerhaften Metrums
bedient.“
|
|
1839
|
Anonym. Frankreich. In: Bayerische National-Zeitung, 10. März München. Digitalisiert von Google
“[S. 170] Frankreich
Der Charivari äussert: ´Wenn man sieht, wie die schon einmal verschiedenen Minister des Aprils die Geschäfte führen, so erinnert man sich unwillkürlich an die in
der bekannten Ballade Bürgers enthaltenen Worte: ´Hurrah! die Todten reiten schnell!´ “
|
|
1839
|
Anonym. Antwort auf Fragen und Klagen, die bekannte Gesangbuchsangelegenheit betr. In: Allgemeine Kirchen Zeitung, 22. August. Darmstadt. Digitalisiert von Google
“[Sp. 1085] Verlieren wir kein Wort über diesen so gehässigen Aufsatz, dessen Nichtigkeit sich jedem Sachkundigen von selbst ergibt, sondern überlassen ihn seinem Schicksale,
wohlbedenkend: die schlechtesten Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen. “
|
|
1839
|
v. Maurer. Aus München. In: Zeitung für die elegante Welt, 27. April. Leipzig. Digitalisiert von Google
”[S. 328] Auch einige Dichtungen sind darin mitgetheilt. Der Hauptgegenstand des Werks ist jedoch juridisch und dies ist wohl das erste Buch, das den Rechtszustand von Griechenland
näher beschreibt. Indem man dies schon mit Beifall aufgenommene Werk wieder in Erinnrung bringt, möchte man auch wohl an das bekannte Sprüchwort erinnern: ´Die schlechtesten Früchte sind es nicht, woran die Wespen
nagen.´ - Nein, es sind gewöhnlich die reifen, besten und nahrhaftesten Früchte.“
|
|
1839
|
Firnhaber, C. G. [Rez] Commentatio de Heratii od. lib. III, c. 14.
von Dr. Ernst Kaestner 1835. In: Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 28. Juni. Darmstadt. Digitalisiert von Google
“[Sp. 614] Wie Hr. K. es für a re axoria alienum halten kann, dass die Frauen beim Wiedersehen ihr überstandenes Leid dem wieder gewonnenen Freunde erzählen, begreifen wir nicht. Wir
möchten an die Bürger'sche Ballade erinnern, es fallen Einem unwillkürlich die Worte ein: ´Holla, thu' auf mein Kind, schläfst Liebchen oder wachst du? Wie bist noch gegen mich gesinnt? Und weinest oder lachst du?´
Es ist so natürlich, was der Dichter sie antworten lässt ´ach! Wilhelm, du? so spät bei Nacht? Geweinet hab' ich und gewacht; ach! grosses Leid erlitten!´
Aber, sagt Hr.
K., solche Klagen sind mit dem Römischen Charakter unverträglich. Das ist eine eigenthümliche Ansicht, die aber in den Commentaren vielfach herrscht. Als ob die damaligen Menschen nicht auch Fleisch und Blut gehabt
haben. “
|
|
1839
|
M. Z. Hanswursts Briefe aus Wien. In: Neues Tagblatt für München und Bayern, 8. Februar. Digitalisiert von Google
“[S. 175] Conducteurs sind nämlich auch nicht unsterblich, wie ich, und als eben ein Wiener Eilwagen aus der Hauptmauth abfuhr, schwang ich mich behende hinauf, setzte mich auf die
Decke, um die Reise auf kaiserliche Kosten zu machen, und:
Hurre hurre, hopp hopp hopp!
ging's zwar nicht immer im sausenden Galopp, doch ziemlich rasch und munter durch Böheims Gauen auf die mährischen Berge [...]. “
|
|
1839
|
Anonym. Rom und die Revolution. In: Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland, Vierter Band. München. Digitalisiert von Google
“[S. 351] Der Eigner irgend einer drolligen, oder barocken, oder absurden Idee, an die sich sein Kopf festgerannt hat, steckt dieselbe außer sich gleichsam auf eine Stange, und stürmt
dann über Stock und Stein, durch Moor und Gestrippe derselben zu, ohne zu sehen, was um und neben und unter ihm ist; und immer wieder und von allen Seiten und bei jeder Veranlassung sieht von neuem sein Auge das
Pünktchen auf der Stange;
Und hurre, hurre, hopp, hopp, hopp,
Gehts fort in sausendem Gallopp. “
|
|
1839
|
Diesterweg, Adolph. Von dem Rhythmus beim Lesen. In: Praktischer Lehrgang für den Unterricht in der deutschen Sprache. Dritter Theil. Crefeld. Digitalisiert von Google
“[S. 187] Noch verdient bemerkt zu werden, daß die Malerei der Stimme überall besonders da anzuwenden ist, wo der Dichter zur lebhaften Versinnlichung malerische Ausdrücke gewählt hat. Dieses gilt z. B. in vorzüglichem Maße von einigen Gedichten Bürger's: Der wilde Jäger — Karl
von Eichenhorst — Lenore, namentlich in den Stellen, in welchen der eilende Hufschlag des Rosses des ankommenden, nächtlichen Reiters durch das ´Trapp, trapp, trapp,´ und ´Hopp, hopp, hopp,´ so wie das ´Kling ling ling´ des angezogenen Pfortenringes, dann der grausige hohle Ton der Stimme des gespensterartigen durch die Pforte Ankommenden, das ´Hurre, hurre" und ´Husch husch husch´ des nachsausenden Gespensterspuks, das Geheul aus hoher Luft, das Gewinsel aus tiefer Gruft, der heulende Chorgesang der tanzenden Geister dargestellt wird. Es gewährt darum ein sinnlich geistiges Vergnügen, ein solches Kunstwerk aus dem Munde eines wahren Künstlers, z. B. von Tiek oder Schlegel zu vernehmen. “
|
|
1839
|
Anonym. Frankreich, Paris, 3 März. In: Allgemeine Zeitung, 8. März. Augsburg. Digitalisiert von Google
“[S. 532] Der Charivari äußert: ´Wenn man sieht, wie die schon einmal verschiedenen Minister des Aprils die Geschäfte führen, so erinnert man sich unwillkürlich an die in der bekannten Ballade Bürgers enthaltenen Worte: ´Hurrah! die Todten reiten schnell!´ “
|
|
1839
|
Baltzer, Eduard. Sinai überall! In: Alte und Neue Welt-Anschauung. Nordhausen. Digitalisiert von Google
“[S. 39] Ehre und guter Name ist für den guten Menschen ein hohes Gut: es ist das Band, das ihn mit dem edlern Theil der menschlichen Gesellschaft verbindet, es ist sein eigener Trost
und Stolz, sein bestes Erbe für seine Kinder. Aber das sind ja eben die
schlechten Früchte nicht, woran die Wespen nagen! Die Wespen, das sind nämlich die schlechten Leidenschaften, Neid, Ehrsucht, Habsucht,
Schadenfreude, Eifersucht, Klatschsucht, Lust an der Intrigue, Brodneid, und wie sie alle heißen: sie alle aber, — wer hätte
es nicht erfahren, — brauchen den Stachel der Verleumdung gegen Freunde und Bekannte, geschweige denn gegen Feinde! “
|
|
1839
|
Weber, Karl Julius. Freiheitsschwärmerei. In: Carl Julius Weber's sämmtliche Werke. Zweiundzwanzigster Band. Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 102] Warum mußte uns Deutsche die republikanische Schwärmerei ergreifen? Klopstock, der von Pensionen der Fürsten lebte, sonst wäre es ihm ergangen, wie Homer, Milton und Cervantes; Klopstock schwärmte, und sang:
Verzeiht o Franken! Namen der Brüder ist
Der edle Name), daß ich den Deutschen oft
Zurufte, das zu fliehen, warum ich
Ihnen jetzt flehe - euch nachzuahmen!
Bürger sang bei'm schlechten Kriegsanfang der Gallier:
Wer nicht für Freiheit sterben kann,
Der ist der Kette Werth,
Ihn peitsche Pfaff' und Edelmann
Um seinen eig'nen Herd!
und Campe's Schwärmereien in Prosa in seinen Briefen aus Paris gingen noch weiter. “
|
|
1839
|
Anonym. Erzählungen über die zehn Gebote Gottes. Sulzbach. Digitalisiert von Google
“[S. 536] Nur große, durch Weisheit und Frömmigkeit ausgezeichnete Männer wurden gewöhnlich verleumdet; von ganz gewöhnlichen
Menschen sagt man selten viel. Daher das alte Sprüchlein meistens eintrifft:
´Wenn dich die Lästerzunge sticht,
So laß dir dieß zum Tröste sagen:
Die schlecht'sten Früchte sind es nicht,
Woran die Wespen nagen.´ “
|
|
1839
|
Anonym. Ausgestellte neue Bildwerke im Kunstvereine zu München. In: Der Bayerische Eilbote, 6. November. München. Digitalisiert von Google
“[S. 791] E. Neureuther. Die Pfarrerstochter von Taubenheim, nach Bürger.“
|
|
1839
|
Dumrath, Hermann. Brief an Alfred Escher, Heidelberg, Dienstag, 13. August. In: Homepage der Alfred Escher Stiftung
" Lieber Alfred.
Wenn Du aus dem vorliegenden Schreiben ersiehst, daß ich Dir in den letzten Monaten so nahe gewesen bin, wenigstens doch näher als Du wohl geglaubt hast, und auch nahe im
Verhältniß zu der großen Entfernung, die uns fortan trennen wird, so zürnst Du mir vielleicht, daß ich nicht eher von hier aus an Dich geschrieben habe. Muß ich nun auch hierin meine Nachläßigkeit anerkennen, und
deshalb in etwas peinlicher Verlegenheit Dich um Entschuldigung bitten, so soll doch diese Peinlichkeit einen Fehler eingestehen zu müssen, mich nicht dazu bringen, es so zu machen wie der gute Dichter Bürger, der
erst zu schreiben versäumte und es dann von Tag zu Tag so lange aufschob, bis er sich schämte zu schreiben. Ich überwinde lieber diese Scham und schreibe jetzt, da ich Dir noch örtlich nahe stehe, denn geistig werde
ich es stets bleiben, um von Dir lieben Freund vor meiner am 25n d. M. erfolgenden Abreise nach Stettin, Abschied zu nehmen.”
|
|
1839
|
Anonym. Verschiedenes. In: Beylage zur Wiener Zeitschrift [für Kunst, Literatur, Theater und Mode] / Allgemeines Notizenblatt 20. Digitalisiert von Google
“[o. S.] Der deutsche Volksdichter Bürger wird immer berühmter. Ein junger Deutscher, Namens Rosani, der schon acht Jahre in der Türkey lebt, hat seine Balladen ins
Türkische übersetzt, und die erste Sultaninn studiert gegenwärtig an der
Ballade: ´Ritter Carl von Eichenhorst.´”
|
|
1839
|
Echtermeyer, Ernst Theodor und Arnold Ruge. Der Protestantismus und die Romantik. In: Hallische Jahrbücher
für deutsche Wissenschaft und Kunst, 25. December. Digitalisiert von Google
“[Sp. 2458] Dem genialen Ich leistet jeder Inhalt, wie dem Schneider jede Mode, denselben Dienst, nämlich den, sich als den überraschenden, wunderbaren Künstler zu zeigen; und
so wäre denn das ganze Geschäft der Propaganda nichts als der reinste Dilettantismus gewesen, August Wilhelm Schlegel aber in der Eitelkeit der Romantik immer noch vorzugsweise das eitle Subject, welches mit fremden Federn, die ihm schief zu Gesichte stehen, eine Weile sich aufputzt und gezwungen brüstet, dann aber den ganzen Putz unbekümmert von sich wirft und dagegen der Reformation und der Wahrheit das Wort redet, ohne gleichwohl sich selbst von der Willkür des Genialisirens zum Gesetz der Philosophie bekehrt zu haben, weswegen denn das letzte Bekenntniß eben so unwahr ist, als das erste.
Gregorius fuhr ums Morgenroth
Empor aus schweren Träumen:
Bist untreu, Wilhelm? o der Noth! -
Da schrieb er ohne Säumen:
Was immer er geschrieben,
Er sei sich treu geblieben.
Es ist wunderbar fein, wie er in dieser Broschüre
patriotischen Verdienste beweist, so fein, daß der Beweis immer nur seine Eitelkeit, nie seine Tapferkeit an den bringt.”
|
|
1839
|
Anonym. Das Testament eines Capitalisten. In: Münchner Kurier für Stadt und Land, 11.03.
“[S. 123] Wie nun in
jedem ordentlichen Haushalte auf ausserordentliche Fälle Bedacht genommen wird, habe auch ich über den besonderen Fall - der zwar nur einmal, aber gewiß eintritt, wenn nämlich:
Das Gerippe
Mit Stundenglas und Hippe
wie der wackere Bürger singt, (die modernen Dichter hab' ich nicht gelesen) mich zum berühmten Baslertanz
auffordert - in einsamen Stunden nachgedacht, und damit meine Verlassenschaft kein Zankapfel lachender Erben und ränkesüchtiger Advokaten werde, [...].”
|
|
1839
|
Hiesiges. In: Augsburger Tagblatt, 11.12.
“Die Anträge des Handelsausschusses müssen wirklich gut seyn, da sie, - ehe sie öffentlich bekannt, - schon so leidenschaftlich angegriffen werden. ´Die schlecht'sten Früchte sind es nicht, woran die Wespen nagen! - Kommt es mir doch vor, als wäre der Korrespondent der in Gott ruhenden Münchner Flora wieder auferstanden!”
|
|
1839
|
Claudius, Matthias. Rom und die Revolution. In: Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland, München
“[S. 351] Der Eigner irgend einer drolligen, oder barocken, oder absurden Idee, an die sich sein Kopf festgerannt hat, steckt dieselbe außer sich gleichsam auf eine Stange, und stürmt dann über
Stock und Stein, durch Moor und Gestrippe derselben zu, ohne zu sehen, was um und neben und unter ihm ist; und immer wieder und von allen Seiten und bei jeder Veranlassung sieht von neuem sein Auge das Pünktchen auf
der Stange:
Und hurre, hurre, hopp, hopp, hopp,
Gehts fort in sausendem Galopp.”
|
|
1839
|
Anzeige. In: Jeversches Wochenblatt 13.10.
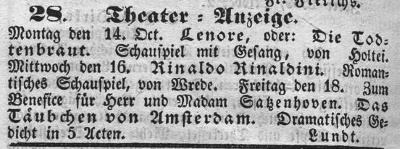
|
|
1839
|
Anzeige. In: Leipziger allgemeine Zeitung 30.06.
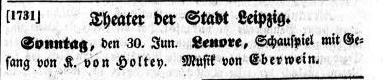
|
|
1840
|
Dingelstedt, Franz. Unter der Erde. Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 103] Ihre Wahl war auf einen sentimentalen Stoff gefallen, Pope's Brief Abälard's an Heloisen. Emilie hatte ihn gelesen; mit welchen Empfindungen sie sprach und er lauschte,
braucht nicht beschrieben zu werden. Nachher war noch weiter die Rede von dem Gedichte, und Edmund erwähnte der schönen Uebertragung desselben durch Bürger. Eine Bitte seiner Gemahlin bestimmte ihn, das Buch zu
holen; sie blätterte darin und stieß auf das berühmte ´Als Molly sich losreißen wollte.´ - Ach! eine Elegie! rief sie aus. Höre, Edmund! das muß hübsch sein. Bitte, lies. - Er kannte Situazion und Dichtung, stockte
und weigerte sich. - Aber, wie Du seltsam bist! Thu´ Deiner kranken Frau doch auch einmal was zu Willen! Ich bin nun heute für das empfindsame Genre portirt, und patriotisch muß man auch sein. Wir lesen nun
seit vierzehn Tagen nichts als Franzosen und Engländer, gerade, als ob wir noch zu Zeiten Friedrich's des Zweiten lebten und keine deutsche Litteratur existirte. Komm Eigensinn! Lies hübsch! - Damit reichte sie ihm
das aufgeschlagene Buch dar.
Er begann. Bald riß ihn die Leidenschaftlichkeit der Worte hin, er vergaß den fremden Dichter und die fremde Veranlassung, sein eigenes Herz flammte,
flutete, flehte in den Reimen. Es irrte ihn nicht, daß Emilie plötzlich mit ihrem Sessel in das Dunkel zurückrückte und den Lichtschirm nach ihrer Seite vorschob. Er las immer lauter, immer besser, bis zu den Zeilen
gegen den Schluß:
Freier Strom sei meine Liebe,
Wo ich freier Schiffer bin!
Harmlos wallen seine Triebe
Wog´ an Woge dann dahin.
Laß in seiner Kraft ihn brausen -
Da brach ihm Kraft und Stimme. Auffahrend schleuderte er das Buch weit von sich und stürzte hinaus. “
|
|
1840
|
Bruckner, Friedrich K. Jugendbibliothek deutscher Classiker, Band 2.
“[S. 395] Was Bürgern als Dichter auszeichnet und ihm einen ehrenvollen Namen in der Geschichte unserer Literatur sichern wird, ist sein Bestreben, den Deutschen eine volksthümliche
Poesie zu schaffen, wodurch er einerseits alles Fremde und Ausländische abwies, und anderseits verlangte, daß die Gegenstände und deren Behandlung so beschaffen seien, daß sie der Auffassungs- und Empfindungsweise
der Nation angemessen seien. Nun ist freilich nicht zu läugnen, daß er in manchen seiner Hervorbringungen das Volk mit dem Pöbel verwechselte, und durch das Bestreben, populär und allgemein ansprechend und
verständlich zu werden, nicht selten trivial und gemein wurde; aber immer hat er einen Weg gezeigt, wie man den Freunden der Dichtkunst gefallen und selbst höheren Ansprüchen genügen kann, ohne gerade seinen
Gegenstand und seine Formen den Griechen und Römern zu entlehnen. [unter Balladen und Romanzen: Das Lied vom braven Manne, Der wilde Jäger] “
|
|
1840
|
Anonym. Rezension Cornelius-Münchhausen. In: Blätter für literarische Unterhaltung
“ Lieblingsbücher in alten und neueren Geschichten, Sagen und Schwänken. Zur Ergötzlichkeit für alle Stände in eine Sammlung gebracht, auch hin und wieder mit dienlichen Bildern geziert
durch Willibald Cornelius. 3ter, 4ter Theil: Münchhausen´s Lügenchronik (4 Abth.) Mit vielen Abbildungen. - Auch u. d. T.: Lügenchronik oder wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, und lustige Abenteuer des Freiherrn
v. Münchhausen, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt. Vollständig in 4 Abth. Gr. 12, Stuttgart, Scheible 1839.1 Thlr. 12 Gr.
[S. 136] Die neueste, N-r
unterschriebene Vorrede bestätigt nun, daß Bürger der eigentliche Abfasser des Werkleins ist, berichtet aber dabei, daß auch Lichtenberg und Kästner, die beiden witzigen Gelehrten Göttingens, starken Theil daran
haben; so sei aus heitern Tischreden, in welchen, nach alter deutscher Weise, diese drei göttinger Matadore sich in ergötzlichen Übertreibungen überboten, das Büchlein entstanden, zu welchem Bürger die Volkswürze,
Lichtenberg und Kästner, mit der schalkhaften Amtsmiene des Katheders und der Societät der Wissenschaften, den flüchtigen Geist der Laune und das Bittersalz der Ironie beisteuerten. Der Denkspruch auf der Kehrseite
des Titels:
Glaubt's nur, ihr gravitätischen Herrn,
Gescheite Leute narrieren gern
sowie die ganze Narration selber, bezeugt eben diesen Sinn. “
|
|
1840
|
Wagner, Johann Jakob. Dichterschule. Ulm. Digitalisiert von Google
“[S. 17] Im Jahrmarkt zu Plundersweilern hat Göthe die Idee des bunten Durcheinandertreibens der verschiedenen Formen des Menschenlebens gefaßt, und in der völlig indifferenten Behandlung der entgegengesetzten Formen trefflich spielend behauptet, und in der Braut von Korinth hat er den Vampyr benützt, um die Idee eines nur mit der gänzlichen Vernichtung des Leibes der beiden Liebenden erlöschenden Geschlechtsverhältnisses durchzuführen, weil der Leib als Träger der Liebe erscheint. Durch das Geistermäßige erinnert diese Romanze an Bürgers Lenore, in welcher die in den Leib versunkene Liebeswuth durch ein Gespenst zu Tode gefoppt wird. Beide Romanzen sind sich auch nach ihrer Idee innerlich tief verwandt und mir ist es nicht unwahrscheinlich, daß Göthe die Lenore lange mit Neide betrachtete, bis er ihr eine Braut von Korinth gegenüberstellen konnte, so wie ohne Zweifel sein Hermann und Dorothea aus dem Wunsche entstanden ist, die Vossische Louise durch ein lebenreicheres und tieferes Gemälde zu überbieten. Bürger's Lenore ließ sich nun freilich nicht überbieten, das Mögliche war schon, etwas neben sie hinzustellen, das die Vergleichung mit ihr nicht zu scheuen brauchte.“
|
|
1840
|
Kobbe, Theodor von. Zehntes Kapitel. In: Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben in Heidelberg und Kiel in den Jahren 1817-1819. Bremen. Digitalisiert von Google
“[S. 131] Nie vergesse ich Zimmermann´s Begeisterung, als er eines Abends aus der Freimaurer-Loge zurückgekehrt war und erzählte, daß Schröder Bürgers ´Lenore´ im schwarzen Anzuge mit
einem weißen Stäbchen in der Hand, so begeisternd [g]esprochen habe, daß alle Anwesenden die Geistererscheinung mit eigenen Augen wahrzunehmen zu haben geglaubt hätten.“
|
|
1840
|
Hurter, Friedrich Emanuel von und Hurter, Christian G. . Der Antistes Hurter von Schaffhausen und sogenannte Amtsbrüder. Schaffhausen.
“[S. 103] Darauf Nro. IV in breiter Mundfülle: er habe auch schon gegessen. Die katholischen Geistlichen seyen aber nach dem Essen ganz anders als während des Essens, dann trete die Polemik mit ihrer ganzen Unduldsamkeit hervor.*
* Da fällt einem aus Bürgers: ´Ich will einst mit Ja und Nein´ [Zechlied], folgende Strophe ein:
Ich bin gar ein armer Wicht,
Bin die feigste Memme,
Halten Durst und Hungerqual
Mich in Angst und Klemme;
Schon ein Knäbchen schüttelt mich,
Was ich auch mich stemme;
Einem Riesen halt ich stand
Wenn ich zech und schlemme. “
|
|
1840
|
Anonym. Mosaik. In: Bohemia, ein Unterhaltungsblatt. Den 31. Juli. No. 91.
"[o.S.] In Paris ist ein Drama "Leonore" aufgeführt worden, in welchem zwar nicht Bürger´s Leonore, aber Bürger selbst auftritt. Diesem Drama liegt Bürger´s
unseliges Verhältniß zur Schwester seiner Frau, die er unter dem Molly feiert, zu Grunde; aber Bürger´s Charakter ist so entstellt, die Handlung ist so ungeschickt verdreht, daß da Publikum den Schluß für eine
Mystifikation hielt. "Die Zuschauer," sagt die Revue de Paris, "waren einmal im Zuge zu zischen; zuletzt zischten sie, wie ein ganze Nest voll Vipern." - Bürger ist also der zweite deutsche
Dichter, den die französische Bühne mißhandelt: der erste war Göthe. - - "
Sowohl Heinrich Heine als auch der anonyme Rezensent beziehen sich auf das Drama in einem Act “Lénore” von M. Jules Loiseleur. Man findet es hier in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1840
|
Kehrein, Joseph. Die dramatische Poesie der Deutschen. Zweiter Band. Leipzig
“[S. 7] Von den vielen ausgezeichneten Lyrikern nenne ich, außer Goethe und Schiller, noch besonders zuerst die Dichter des Göttinger Hainbundes. Gottfried August Bürger,
in dem Phantasie und plastisches Talent sich aufs glücklichste vereinigten, hat trotz der harten Angriffe Schillers dennoch als Volksdichter, als Meister im Sonnett und in der Ballade sich Bahn unter dem deutschen
Volke gebrochen. “
|
|
1840
|
Anonym. Stralsundische vermischte Nachrichten. In: Sundine. Unterhaltungsblatt für Neu- Vorpommern und Rügen. Stralsund 23. September. Digitalisiert von Google
“[S. 312] Freitag, den 18ten, bei vollem Hause, ´Lenore´, Schauspiel mit Gesang in 3 Acten, von C. von Holtei. Ein bekanntes und berühmtes Stück, — der nicht minder bekannten und
berühmten Bürgerschen Ballade nachgebildet, und von dem patriotisch gesinnten Verfasser zum vaterländischen Stücke aptiret. Die eingelegten Musikstücke und deren Melodieen befinden sich zum Theil im Munde des Volks,
z. B. das beliebte Mantellied. Es muß schon manches Jahr her seyn, daß dies Schauspiel nicht bei uns in Scene getreten. Früher sahen wir es hier häufig mit dem entschiedensten Beifall, und bot nun die Rückerinnerung
uns den Stoff zu einer interessanten Vergleichung. Die kleinen Lieder wurden mit Ausdruck und Wärme, und namentlich das bereits erwähnte Mantellied von Herrn Hesse (Wallheim) mit vieler Innigkeit vorgetragen. Beim Beginne desselben schien uns ein kleines Versehen bei den Blase-Instrumenten einzutreten, doch glücklicher Weise dauerte es nicht lange, und Alles kam bald wieder in Ordnung. Die Darstellung der Hauptrollen Wilhelm und Lenore (Herr und Madame Pollert)
erwarb einstimmigen Beifall, auch kann, unsers Erachtens, der Pastor Bürger (Herr Schwemer) wohl nicht leicht besser gegeben werden. Dem gespenstischen Wolkenritt aber, mit welchem Bürgers Ballade und auch
das Stiick schließt, sahen wir hier schon besser und mit täuschenderer Wahrheit executiret.“
|
|
1840
|
Anonym. Preußen. In: Der Neuigkeits-Bote. Berlin. Digitalisiert von Google
“[28. Januar] Neben ´Till Eulenspiegel´ lebt seit 50 Jahren schon im Munde unseres ganzen deutschen Volks der noch lustigere Münchhausen fort und fort, und wenn auch unter den geehrten Lesern d. Bl. gewiß Jeder schon etwas Launiges und Drolliges von diesem gehört, so wissen doch nur wenige die Quelle, aus welcher alle die Münchhausen´schen Witze, Schwänke und Streiche geschöpft sind. Jetzt aber liegt diese Quelle sauber vor uns, und wir beeilen uns darum auch, sie hier unsern Lesern zu nennen. So eben erschien nämlich im Verlage unseres wackern Mitbürgers Hrn. Buchhändlers Enslin (Dorotheenstr Nr. 4) eine mit 16 Federzeichnungen vom trefflichen hiesigen Genre-Maler Hrn. Hosemann gezierte neue Ausgabe von des weltbekannten ´Freiherrn von Münchhausen wunderbaren Reisen und Abentheuern zu Wasser zu Lande, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegte.´ In diesem Geistesprodukte, an welchem bekanntlich Kästner, Lichtenberg und besonders der berühmte Volksdichter Bürger großen Antheil haben, erhalten Leser jedes Standes und Alters eine Lektüre, die in ihrem unveralteten Reize einen wahren Schatz an gutem Humor und feiner Ironie, eine Fülle von kernigem, harmlosen Witz, kurz, eine so gesunde und pikante Geistesnahrung bietet, wie sie in unserer ephemeren Tagesliteratur selten ist. Dabei ist der Preis eines halben Thalers dafür so überaus mäßig, daß er wohl Niemand vom Ankauf dieses abhalten wird.“
|
|
1840
|
Gerhard Anton v. Halem´s Selbstbiographie nebst einer Sammlung von Briefen an ihn. Oldenburg. Digitalisiert von Google
“[S. 113] Brief von Boie. Meldorf, den 20. Jan. 1791. [...]
Die ersten dreyßig Stanzen des Giocondo, die Bürger mir geschickt hat, waren ganz in seinem besten Tone. Vermuthlich
wird das das Hauptstück der neuen Ausgabe.
[S. 121] Brief von Stolberg. Emkendorf, den 12. Jun. 1791. [...]
Et tu Brute? Auch Sie sind mit der Recension der Bürgerschen Gedichte zufrieden? Scheint Ihnen,
daß alle lyrische Dichter der Deutschen so weit unter Bürger stehen, als dieser unter dem Ideal des anonymen Journalisten? Ueber dieses Ideal - denn er scheint versificirende Kantianer anf dem Parnaß zu wünschen -
scheint mir Bürger, der ein wahrer Dichter ist, weit erhaben; und andre nicht unter ihm, und Klopstock weit über ihm. Voß las mir diese Recension vor 6 oder 8 Wochen vor, und empfand, was ich empfinde. Ich kann mir
nicht vorstellen, daß Schiller, der eben als lyrischer Dichter, meiner Empfindung nach, groß war, dieses Urtheil gefällt haben soll. Und doch, wer weiß? - da Sie es gut finden.“
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1840
|
Anzeige. In: Neue Würzburger Zeitung. 20. Juli. Digitalisiert von Google
“ Neuerbauter
Circus Gymnasticus
vor dem Sanderthore. 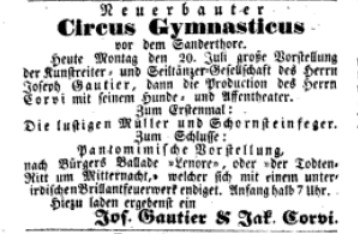
Heute Montag den 20. Juli große Vorstellung
der Kunstreiter- und Seiltänzer-Gesellschaft des Herrn
Joseph Gautier, dann die Production des Herrn
Corvi mit seinem Hunde- und Affentheater.
Zum Erstenmal:
Die lustige Müller und Schornsteinfeger.
Zum Schlusse:
Pantomimische Vorstellung,
nach Bürgers Ballade ´Lenore´, oder ´der Todten-
Ritt um Mitternacht,´ welcher sich mit einem unter-
irdischen Brillantfeuerwerk endiget. Anfang halb 7 Uhr.
Hiezu laden ergebenst ein
Jos. Gautier & Jak. Corvi. “
|
|
1840
|
Heine, Heinrich. Beilage. In: Allgemeine Zeitung. 1. August 1840.
“[Paris, 25 Julius] Auf den hiesigen Boulevardstheatern wird jetzt die Geschichte Bürgers, des deutschen Poeten, tragiert; da sehen wir, wie er, die Leonore dichtend, im Mondschein
sitzt und singt: hurra! les morts vont vite - mon amour, crains-tu les morts? Das ist wahrhaftig ein guter Refrain, und wir wollen ihn unserm heutigen Berichte voranstellen, und zwar in nächster Beziehung auf das
französische Ministerium.”
|
|
1840
|
Jerrer, Georg Ludwig. Gottfried August Bürger. In: Die Weltgeschichte für Kinder.Sechste Auflage. Zweiter Theil. Nürnberg.
“[S. 484] Gottfried August Bürger, erst Amtmann zu Alten-Gleichen, dann Professor zu Göttingen (geb. 1748, gest. 1794), dichtete Lieder von unbeschreiblicher Lieblichkeit, theils
tändelnd, naiv, populär, theils erhaben und voll starker und wahrer Gedanken. Unübertrefflich war er besonders in seinen Romanzen, unter denen einige voll herzergreifender und Entsetzen erregender Stellen sind;
andere aber auch von muthwilliger Laune überströmen. Kein deutscher Dichter war seiner Sprache mächtiger, als Bürger; kein anderer erlaubte sich aber auch, wie er, so viel Gemeinheiten, die man selbst an einem
Bänkelsänger anstößig finden würde.”
|
|
1840
|
Rinne, Johann Karl Friedrich. Einleitung in die Gesammtlehre vom deutschen Stile. In: Die Lehre vom deutschen Stile. Ersten Theiles erstes Buch. Stuttgart. Digitalisiert von
Google
“[S. 162] Ganz auf die Adelung´sche Theorie gestützt ist auch:
Gottfr. Aug. Bürger, über Anweisung zur teutschen Sprache und Schreibart auf Universitäten. Göttingen 1787. 8. Neu herausgegeben
von Karl von Reinhard unter dem Titel: G. A. Bürger´s Lehrbuch des deutschen Styles. Berlin 1826.
Anmerkung. Bürger geht von Adelung's Sprachansichten, großentheils selbst mit dessen Worten aus; er führt also die Stiltheorie nicht um
einen Schritt weiter; aber er entwickelt manche Materien gewandter und ausführlicher, gibt reichere Beispiele, und weicht im
Einzelnen, vorzüglich in Geschmacks- und Gefühlssachen von jenem Gelehrten ab. “
|
|
1840
|
Visino, Johann Nepomuk. Sechster Brief. Cahiro, den 13. April. In: Meine Wanderung nach Palästina. Passau. Digitalisiert von Google
“[S. 196] Unter dem Kinne durch, über die beiden Wangen wird ein Musselin-Tuch gezogen, und am Scheitel in eine zierliche Schleife geknüpft; eben so wird über Mund, Nase und Stirne ein
Stück Musselin über Scheitel und Kleingehirn gezogen und am Nacken durch eine Schleife befestigt. Hierauf werden die Augen wiederholt mit Rosenwasser begossen, mit Baumwolle belegt, und der Kopf ringsum mit Musselin
umwickelt.
Während des Waschens und Einhüllens singt der Muessin (oder Scheich, oder Imam) sein monotones Lied, von welchem gilt, was Bürger sagt:
´Das Lied ist zu vergleiche
Dem Unkenruf in Teichen.´
Die Leiche wird dann in einen offenen Sarg gelegt, und zu Grabe getragen; [...]. “
|
|
1840
|
Wangenheim, Franz Theodor. Die Schlacht bei Jena. In: Der Spion. Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 115] ´Du empfindest das, meine Luise und, Gottlob, daß Du es empfindest. Nun ist mir nicht mehr bange, daß einst - - - was wollte ich doch sagen? Ja doch - es will nur nicht recht
passen - kennst Du - kennst Du das Lied von der liebenden Leonore? - Du wirst blaß? - Meine Luise´ - schloß er sie in die Arme - ´Geduld, Geduld wenn's Herz auch bricht; mit Gott im Himmel had´re nicht! - Mehr weiß
ich nicht, mehr sage ich nicht! - Jetzt suche deine Mutter.´ “
|
|
1840
|
Anonym. Miscelle. In: Der Bayerische Eilbote. 17. Mai. München. Digitalisiert von Google
“[S. 479] Wenn der Herr Abonnent ein Pferd hat, so spannt er es auch nicht alle Tage ein, und ein Pferd braucht nur eine Person zu ziehen; ein Schriftsteller aber muß ein ganze Publicum
ziehen, anziehen und - wenn er's versteht, groß ziehen; Auch des Eilboten innigster Wunsch ist es, sein verehrliches Lesepublicum an- und vorzüglich groß zu ziehen; aber Wunsch und Wirklichkeit sind ganz heterogene
Wesen. Freilich richtet er all sein Bestreben zur Erfüllung dieses Wunsches, aber, - die verfluchten aber!
Wer das Wenn und das Aber erdacht,
Hat sicher aus Häckerling Gold schon gemacht. “
|
|
1840
|
List of New Publications. In: The Edinburgh review. Edinburgh. Digitalisiert von Google
“[S. 576] Fine Arts: Retzsch's Outlines to Burger's Leonora. Oblong 4to. 16s “
|
|
1840
|
c. Theater, den 24. Mai. In: Augsburger Tagblatt, No. 145 vom 26. Mai. Augsburg. Digitalisiert von Google
“[S. 633] ´Lenore, oder die Vermählung mit dem Grabe.´ Dieses Schauspiel von Holtei ist Zeile für Zeile nach Bürgers Ballade und zwar schmuck- und kunstlos bearbeitet. - Die Musik von
Eberwein ist ein Gemisch veralteter Melodien, und so konnte es auch nicht fehlen, daß kein besonderer Geist die Darstellenden beseelte, um mit ihren Leistungen zufrieden seyn zu können. - Nur der Drang der
Nothwendigkeit konnte die Titelrolle in die Hände einer Dame legen, die derselben durchaus nicht gewachsen ist, und es wäre daher besser, Stücke zu wählen, die, wenn sie auch nur mittelmäßig besetzt werden könnten,
doch die Illusion nicht so schauderhaft störten. - Herr Hansen, als alter Reiter-Unteroffizier hat eigentlich das Ganze heraushauen und heraussingen müssen, und vom Anfang bis zum Ende bewiesen, wie sehr er
es sich angelegen seyn läßt, die Erwartungen des Publikums zu rechtfertigen. - Hr. Harprecht (Major Freiherr von Starkow) einige Steifheit und Gefühllosigkeit in seiner Rolle abgerechnet, so wie Hr. Witte, als dessen Sohn Wilhelm, spielten sehr brav und gaben nebst Mad. Kuppinger,
die den Charakter der Gräfin sehr treu kopirte, dem Stücke die nöthige Haltung, die es bedurfte, um uns, wenn auch nicht im sausenden Galopp, das Schluß-Tableau mit bengalischer Flamme beleuchtet, so ziemlich
leidentlich herbeizuführen. “
|
|
1840
|
Charles, Jean [d.i. Karl Johann Braun, Ritter von Braunthal] Das Leben kein Traum. Roman in drei Bänden. Erster Band, Stuttgart. Digitalisiert von Google
“[S. 40] Aber Schiller's Balladen sind sehr umfangreich, und sind doch das Beste dieser Gattung, was wir Teutsche haben.
Dieser Gattung? Seine sogenannten
Balladen sind poetische Erzählungen, und dieß nicht sowohl ihres Umfangs als der Haltung wegen, worin sich der Leser zu denselben befindet, den er selbst im Taucher, der balladenähnlichsten Erzählung, in zu grosse Ferne stellt. Bürger's Lenore hält den Leser von Anfang bis zu Ende an die Handlung wie mithandelnd gefesselt, und dieses merkwürdige Gedicht leidet, ausnahmweise, nicht durch den grossen Umfang. “
|
|
1840
|
Löwenthal, J. Triester Taschenbuch für 1840. In: Ost und West. Nro. 14 vom 15. Februar. Prag. Digitalisiert von Google
“[S. 63] Unter anderm finden wir auch eine Uebersetzung von Bürgers herrlicher Leonore in reimlosen Versen, aber so matt, daß man sich des Aergers nicht erwehren kann, wenn man sich an
das Original selbst erinnert.“
|
|
1840
|
Sternberg, A. von. Pulcherie. In: Urania. Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 20] Wir wollen nun noch einen flüchtigen Blick auf die kleine Käthe oder auf Pulcherie, wie sie jetzt heißen wird, werfen. Frau Barbara war zu ihrer Zeit eine recht stattliche
Dorfschönheit. In jenen Tagen, wo man noch nicht immerfort vom Glücke des Volkes sprach, sondern sich damit begnügte, es glücklich zu wissen, war die Jugend der Frau Barbara eine kräftige deutsche Idylle, nicht eine
Geßner'sche. Die Linde stand noch, wo sie als Mädchen den Reihen angeführt, in heitern Mondnächten, den Erntekranz im Haar, mit den jungen Elegants des Dorfes sich herumgeschwungen; aber auch die einsame Laube
existirte noch, wo sie ihre sparsame Fertigkeit im Lesen dazu anwandte, Bürgers ´Leonore´ ihrer Phantasie einzuverleiben. Ach, was waren das für Augenblicke! Der Amtmann zu Altengleichen verstand es, auf die derbe,
gesunde Phantasie des Volkes zu wirken. Barbara vergoß Thränen; der siebenjährige Krieg, die Todtengruft, der ferne Liebste und das Gesindel in der Luft - alles verschmolz in ein einziges großes romantische
Bewußtsein. Hiermit waren aber auch in der rein praktischen Natur Barbara's alle Forderungen der Poesie abgethan. Nicht so bei ihrer Tochter; diese verstieg sich schon zu den Körner'schen Balladen, diese ging als
die reiche Frau eines Pächters monatlich einmal in die Komödie, und Leute, die es wissen können, behaupten, daß sie sogar über Goethe und Schiller ein Urtheil gefällt und diesen über jenen gesetzt. Eine merkwürdige
Thatsache, wenn sie gehörig bewiesen werden kann.
[S. 21] Die kleine Katharine artete nach der Großmutter. Sie ist ein hübsches rundes Kind mit der Poesie der Unschuld in den großen blauen Augen. Die alte Großmutter hat ihr das
vergessene Lied von der schönen Leonore, die ihren Bräutigam nicht erwarten kann, frühzeitig beigebracht, und die Kleine singt nun in hellen Mondnächten jenes schauerliche ´Hopp, hopp, hopp — dahin im sausenden
Galopp!´ des alten Bürger's. Der Schulmeister, der es manchmal hört, schüttelt aber den Kopf und meint, sie werde lange nicht die feine Bildung erlangen wie die Mutter.“
|
|
1840
|
Kobbe, Theodor von. Der Lieutenant J. Die Familie Ditteney. In: Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben. Bremen. Digitalisiert von Google
“[S. 108] Wenn die Familie Ditteney am Abend dem erzählenden Vater, oder dem Sohne, einen Metzger, der in Östreich condicionirt hatte, zuhorchte, schnitten die rüstigen Söhne Faßbänder
in der Hoffnung einer glücklichen Weinlese. Dazwischen ertönten die schnurrenden Spinnräder der Hausfrau, Töchter und der beiden Dienstmädchen, von denen das eine die goldgelockte wunderschöne Maria Er. aus dem benachbarten Odenwalde mit ihrer silberhellen Stimme begleitete. Nie vergesse ich den Eindruck, welchen eine Ballade, (im Sinne des Pfarrers Tochter zu Taubenhain) mit den langsam gezogenen Refrain, in mir erweckte:
Und als er ein Stück gereiset war,
Sieht er sechs Gräber graben.
Wiederum dum da, wiederum dum da,
Sieht er sechs Gräber graben,
Ach liebste liebste Gräber mein
Was grabt Ihr da für'n Grabe,
Wiederum u. s. w. “
|
|
1840
|
Voss, Johann Heinrich. Briefe an Ernestine Boie. In: Briefe von Johann Heinrich Voß. Erster Band. Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 286] Lübeck, 5. December 1775
Den Nachmittag und Abend brachten wir mit Gesprächen, Musik und Fragespiel zu. Die Gerstenberg singt und spielt ganz vortreflich, weit natürlicher
und empfindungsvoller, als die Windhem; und Gerstenberg ist eben so sehr Meister in beidem. Sie sangen aus Bürgers Lenore, und mein Trinklied vor, und spielten darauf einige Stücke zugleich auf dem Klavier, die an
sich schon viel Reiz hatten, und noch mehr durch die schöne Idee der Eintracht erhielten.“
|
|
1840
|
Wagner, Johann Jakob. Dichterschule. Ulm. Digitalisiert von Google
“[S. 346] Das Unglück der Mutter, die ohne Gatten und Vater der Schande preisgegeben ist, hat Bürger in seiner Pfarrerstochter von Taubenhain meisterhaft dargestellt, und seine Lenore zeigt eine Art von weiblichem Werther, der in dem bloßen Gedanken der Nichterfüllung seines einmal eingegangenen Geschlechtsverhältnisses seine Zerstörung schon findet.“
|
|
1840
|
Maltitz, A. von. Der Kopist und der Doppelgänger. In: Deutsche Blätter für Litteratur und Leben München. Digitalisiert von Google
“[S. 374] Eine Thräne fiel, sie hätte jeder Wunde wohl gethan, in die sie gefallen wäre. Der Reisende lehnte schnell sein müdes Haupt an das ergraute Haar seines Bruders. ´Karl, rief
er, wir kommen alle, wie Bürgers Pfarrers-Tochter von Taubenheim, in den Garten der Heimath zurück: das traurige Leben zu enden.´ “
|
|
1840
|
Anonym. Literatur- und Bücherschau. Viktor Käfer's Gedichte, Grätz 1839. In: Deutsche Blätter für Litteratur und Leben München. Digitalisiert von Google
“[S. 126] Er schaute in seine kummervollen Tiefen und schwärmte manchmal über seine Rosenhügel; allein er fühlte auch die Dornen und seltner kam der Nektar an seine Lippen als der
Wermuth, - der allen ächten Dichtern beschiedene Lebenstrank! Wir wurden in der lyrischen Abtheilung nicht selten an unseren Bürger erinnert.
Dies ist gewiß kein Tadel, aber wohl ein Diplom, das man auch dem gerne reicht, der nicht ohne einzelne Mängel ist.“
|
|
1840
|
Mohnike, Gottlieb. Kleinere Gedichte von Esaias Tegnér. Aus dem Schwedischen. Erster Theil, Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 247] Seine [Esaias Tegnér] poetischen Schriften sind theils dramatischer, theils erzählender, theils lyrischer Art; auch hat er einige Lieder deutscher Dichter glücklich ins
Schwedische übertragen, namentlich Schillers Lied ´An die Freude´ und Bürgers Lied ´Von der Treue.´ “
|
|
1840
|
Wagner, H. A. E. I. Abhandlung. Ueber d. Psychagogie des evangel. Geistlichen. In: Neues Journal für Prediger Halle. Digitalisiert von Google
“[S. 145] Drüben lag nämlich, als am Anfange eines Dörfchens, wohin aus der nächsten in der Ferne sichtbaren Landstadt nicht wenige Besucher des eben dort gehaltenen Jahrmarktes
zurückkehrten, ein anmuthiges Gartengrundstück, zur gastlichen Aufnahme eingerichtet; und hierher hatte eine blinde Harfenspielerin mit ihrem auch künstlerisch gebildeten Bruder und Führer sich aus dem Gedränge des
Städtleins geflüchtet, um vielleicht etwas freundlichern Zuspruch oder mehr Acht- und Lenksamkeit der Herzen als dort zu finden. Sie sang eben Bürgers Lied an die Hoffnung nach der schönen Weise: Valet will ich dir
geben, - und als nun die Worte des 6. Verses erklangen, allein von der Blinden vorgetragen unter wenigen sanften Griffen auf ihrem Instrumente, das ihr aber dann, weil sie gerade mit diesem Verse das Lied schloß, zu
dem rührendsten Nachspiel diente:
Du bist es, die dem Kranken
Die Todesqualen stillt;
Mit wonnigen Gedanken
Der Zukunft ihn erfüllt; -
In seinen letzten Träumen
Das Paradies ihm zeigt,
Und unter grünen Bäumen
Die Lebensschale reicht.
als diese Klänge ertönten - und Hirts Blick zufällig dem seines Freundes begegnete, in dessen Augen eine Thräne zitterte, - ach da wallte auch ihm die Brust von inniger Rührung - denn er gedachte der verlornen Lebensgefährtin, wie Eberhard einer frühentschlafenen geliebten Tochter, die gleichfalls der Kunst befreundet und eine Sängerin voll Melodie eben jenen Vers kurz vor ihrem Tode gesungen hatte. “
|
|
1840
|
Anonym. Feuilleton. In: Münchener Unterhaltungsblatt. Beilage zum Bayerischen Volksfreund. No. 66 München. Digitalisiert von Google
“[Sp. 437] Horace Vernet's wunderbarliches Bildniß der ´Lenore´ von Bürger ist nun in einem trefflichen Kupferstich erschienen, der in einer hiesigen Kunsthandlung ausgestellt, das Interesse der Künstler erregt. Der gute Franzose hat sein Bild so ´allemand´ als möglich gemacht, er hat aber eben dadurch bewiesen, daß er nicht Deutsch, oder nichts Deutsches versteht. Ein gepanzerter Ritter, das blonde, naive Fräulein, des Wilhelms Kopf ein Todtenschädel mit Schnurrbart und feurigen Augen, das Grab des alten Recken, Nachteule, Todenzug usw. - das ist alles sehr seltsam, aber von Bürgers ´Lenore´ ist freilich auch gar nichts daran als die Unterschrift. “
|
|
1840
|
Anonym. Kunst-, Literatur- und Theater-Notizen. In: DER ADLER, 27. August Wien. Digitalisiert von Google
“[S. 1631] Wir erhalten so eben eine neue Originalausgabe des Volksbuchs (Göttingen, Dietrich, und Berlin, Enslin) mit 16 trefflichen Federzeichnungen von Hosemann. Die neue Vorrede
stellt die bekannten Zweifel über die Autorschaft zusammen. Die Literaturgeschichte bezeichnete Bürger als Verfasser, da man ihn als denjenigen kannte, der den Volkston zu treffen wußte, und ein Nachdruck von
Bürgers Werken nahm des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer zu Wasser und zu Lande, ohne weiteres mit auf. Zweifelsohne verräth die Abfassung des Buches oft genug Bürgers Hand, Inhalt aber,
Erfindung, Witz, Satyre, kurz Körper und Seele desselben rührt weit mehr von den beiden Koryphäen des deutschen Witze von damals her, von Lichtenberg und Kästner, den Collegen Bürger's an der Göttinger Hochschule.
Bürger gab dem Ding Schnitt und Taille, in welcher es 1788 angeblich als Uebersetzung aus dem Englischen erschien, mit der Angabe London als Verlagsort, ein Einfall, der ebenfalls dem Erklärer Hogarths angehören
mag. Die angebliche Vorrede des fingirten englischen Herausgebers deutet noch auf eine moralische Wirkung de Buches in Bezug auf Parlamentsschwätzer. In Wahrheit aber war der Freiherr für Deutschland selbst in
damaliger Zeit der gerechte Lügenstrafer, der Gleiches mit Gleichem, obschon in starken allöopathischen Dosen zu kuriren suchte. Es war in Niederdeutschland damals die Zeit der Rodomontaden, welche mit der Schlacht
bei Roßbach begann und eigentlich erst bei Jena endet. - Die Federzeichnungen des berliner Genremalers sind in der That vortrefflich; die Gestalt des edlen Freiherrn hat die gehörige Mischung von Verschmitztheit und
Ehrbarkeit. “
|
|
1840
|
Brunner, Sam. Reise nach Senegambien und den Inseln des grünen Vorgebirges im Jahre 1838. In: Gelehrte Anzeigen, 31. December, München. Digitalisiert von Google
“[Sp. 1058] Auch hier in der Stadt fand unser deutscher Reisender, so unbequem auch seine Wohnung in dem kleinen, einer Französin zugehörigen Gasthofe war, sonst überall die
gastfreundlichste, zuvorkommendste Aufnahme und machte unter andern die Bekanntschaft eines Franzosen, der die Stelle eines Schulaufsehers in Gorea begleitet, und der sich mit der deutschen Literatur so vertraut
zeigte, daß er aus Bürgers Gedichten, namentlich das vom Kaiser und vom Abt fast ganz auswendig herzusagen wußte. “
|
|
1840
|
Götte, Wilhelm. Die Literatur. In: Vorschule der Politik, Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 445] In Deutschland aber, wo man alle Arbeiten in Zünfte gebracht hatte, mußte man auch eine Zunft für die Arbeiter am Leisten der Gelehrsamkeit haben, so erhielt man eine
Gelehrtenkaste, und wer sollte nun noch schreiben, da das Geschäft von dieser versehen wird! Sie erhielt ihren Sitz auf den Universitäten, hatte lange ihre besondere Sprache, das Lateinische, und die Wissenschaft
wurde hier, wird wohl noch zunftmäßig betrieben, indem man stufenweis alle Gradationen der Corporation vom Lehrling bis zum Meister hindurchgeht und vom Probe- zum Meisterstück aufsteigt. Was nicht zu dieser Zunft
gehörte, das war lange wie eine ausgestoßene Kaste der Parias zu betrachten. Ein Talent *), wie Bürger, gelangte erst am späten Abend seiner Tage zu der Ehre, zum Professor ertraordinarius ernannt zu werden.
So kam in die Literatur, in welcher ein gleiches Bürgerthum, eine auf die geistigen Fähigkeiten begründete Gemeinschaftlichkeit aller Rechte herrschen sollte, eine Spaltung, die gleichsam einen privilegirten
Stand einer unprivilegirten plebs gegenüber stellte; es entstand ein Unterschied zwischen esoterischen und exoterischen Schriften, jene bereicherten die Bibliotheken, wie sie aus den Bibliotheken entnommen waren,
diese aber gingen in's Volk, und je mehr die steigende Bildung ihre Vermehrung erlaubte oder dazu aufforderte, destomehr wurden die unzünftigen Gelehrten die Arbeiter der Buchhändler, und ein gewisser pruritus in
Geldbeutel und Feder drängte weit mehr zum Schreiben, als die innere Aufforderung. Das Uebelste hierbei ist, daß eine eigentliche Nationalliteratur, welche das Volk befriedigte, sich nicht bilden konnte; die
Gebildeten, von deren Ermunterungen die Erschaffung einer solchen abgehangen hätte, sahen mit vornehmer Gleichgültigkeit auf das sich emporringende Genie herab, und während die Universitäten in ihrer Gelehrsamkeit
versteinert dastanden, wandten jene sich dem Auslande zu, so daß, wenn die Geister nicht selbständig emporgestrebt hätten, wahrscheinlich weniger geleistet worden wäre, als jetzt geleistet worden ist.
* `Auch rühmen sie sich in selbiger Stadt, daß nie die Naturphilosophen bei ihnen gediehn, und daß ein Poet wie Bürger vor Hunger beinah starb.´ Platen. - Und ein Grimm, Stolz des deutschen Namens, ein Dahlmann u. A. wurden von Göttingen vertrieben, schmähliger als Wolf von Halle! O Göttingen, Göttingen mit der Juristenfacultät und dem Schöffencollegium und dem Rade vor dem Gronerthor! O Göttingen, o Gerechtigkeit! O Göttingen mit der Hochgelahrtheit, wo ein Philosoph, wie Krause, Noth leidet, und die Zierden der Wissenschaft wie der Nation geächtet werden. O Göttingen, was für ein Jubiläum hast du gefeiert
[S. 448] Mit dieser Bornirtheit, dieser zunftmäßigen Bewegung des Geistes hängt auch der Autoritätsglaube in Deutschland zusammen. Nirgends wird es dem Genie schwerer, emporzukommen, als hier, und man mag
sich dem akademischen Lehramte, oder der Literatur zuwenden, durch sich selbst wird man schwerlich zur Anerkennung gelangen, und der Mann von Geist eher herabgedrückt, als emporgehoben werden. Ich nenne nur ein
Beispiel, den Philosophen Krause - Schande dem Volke, welches solchen Kopf im Elend umkommen ließ! Wahrlich, was Platen von den Göttinger Meistern der Gelehrsamkeit sagt: ´Auch rühmen sie sich in selbiger
Stadt, daß nie die Naturphilosophen bei ihnen gediehn, und daß ein Poet wie Bürger vor Hunger beinah starb` - man kann es auf die ganze Nation anwenden, in welcher das Genie, wenn es nicht untergehen will, zu den
unwürdigsten Mitteln seine Zuflucht nehmen muß, da der bornirte Autoritätsglaube, das Eigenthum und die Frucht unserer Universitäten, an keine geistige Selbständigkeit und eigenthümliche Größe, an keine durch
unmittelbaren Verkehr mit den Musen erlangte Weisheit glaubt, sondern nur zünftige Meister, Mitglieder der und der gelehrten Gesellschaften anerkennen will. “
|
|
1840
|
F. Mihm., Dorfleben in Leid und Freud. In: Allgemeine Zeitung, Nürnberg. (Digitalisiert von Google)
“[3. October, o. S.] ´Mir ist doch, als wenn er heut kommen müßte, und ach, wie würden wir erschrecken, wenn er käme.´
´Ich nicht, Mutter.´
´Kind, Kind, wer wird so freveln! Weißt du die Geschichte von jener Lenore noch nicht?´
´Nein, Mütterlein, bitte, erzähle sie.´
[4. October, o. S.] ´Es war einmal ein Mädchen, die hieß Lenore und die hatte
einen Bräutigam, der hieß Wilhelm. Und der Bräutigam war ein schwarzer Husar und zog mit dem alten Fritz in den Krieg den Böhmen und da wurde er erschossen. Und als der Krieg aus war und die Soldaten wieder
heimzogen, kam er nicht mit, denn er lag in einem Grab in Böhmen. Aber das Mädchen weinte Tag und Nacht und zürnte auf den lieben Gott und die heilige Religion also, daß ihr Bräutigam keine Ruhe hatte im Grabe. Und
als sie eines Nachts wieder weinte, schlug es eben eilf Uhr und ihr Wilhelm kam angeritten und klopfte an die Hausthür und klingelte und sprach zu ihr: sie sollte mit ihm gehen in sein Haus, da wollten sie Hochzeit
halten. Lenore aber sagte nichts zu ihrem Mütterlein und schlich an die Hausthür und riegelte auf und fiel ihrem Wilhelm um den Hals. Der nahm sie auf sein Pferd hinter sich und ritt mit ihr fort, weit fort und
schnell und immer weiter fort in einen Gottesacker. Da tanzten die Geister drinnen auf ihren Gräbern und heulten garstige Weisen und Roß und Bräutigam versank in ein tiefes Grab, weil es zwölf schlug. Und -´
Es klopfte. Mutter und Tochter schraken zusammen. Niemand wagte zu fragen, herein! Aber es öffnete sich die Thür und herein trat Heinrichs Vater, der alte Schulmeister.“
|
|
1840
|
Anonym. Anekdoten. In: Der Erzähler, 3. Oktober, Augsburg. Digitalisiert von Google
“[S. 320] Im vierten Auftritt des zweiten Aktes von Holtei's Singspiel ´Lenore´ soll ein Spion in Mönchskleidung behutsam über die Mauer klettern und unbemerkt von den spielenden
Personen bleiben. Dem verkappten Mönch zu K. begegnete bei dieser Scene das Unglück, sich in der ungewohnten Kleidung zui verwickeln und wie ein plumper Bär von der Mauer herab auf die Bühne zu kollern. Da Publikum
suchte, theils aus Achtung vor den Mitspielenden, theils aus Furcht, den Eindruck des Stückes zu schwächen, seine Lachlust so gut als möglich zu bekämpfen. Als aber benannter Mönch im sechsten Auftritt der Gräfin
Aurora ganz treuherzig versicherte: ´Ich nehme den Weg zurück, den ich gekommen,´ füllte ein schallendes Gelächter das ganze Haus.“
|
|
1840
|
Leinfelder, Anton. Verläumdungen und Unwahrheiten. In: Lebensfrüchte von Sinai und Golgatha, oder: die Gebothe des Herrn. Augsburg. Digitalisiert von Google
“[S. 507] Nach einiger Zeit wurde der Verläumder gefährlich krank; er erkannte sein großes Unrecht, und wollte beichten. Der Geistliche aber sagte ihm, daß er nie Vergebung der Sünden
erlangen werde, wenn er nicht zuvor dem Pfarrer die geraubte Ehre öffentlich und auch vor Gericht wieder gebe und seine falschen Anklagen zurücknehme. Er that es und starb bald darauf.
Der Pfarrer wurde wieder in sein Amt eingesetzt, und wirkte von nun an erst recht gesegnet.
Wenn dich die Lästerzunge sticht,
So laß dir dieß zum Troste sagen:
Die schlechtsten Früchte sind es nicht,
Woran die Wespen nagen. “
|
|
1840
|
Ditfurth, Maximilian von. Begebenheiten bis zur Rückkehr in das Vaterland.
In: Die Hessen in den Feldzügen von 1793, 1794 und 1795 [...]. Zweiter Band. Kassel. Digitalisiert von Google
“[S. 440] Beim Eintritte in die hessischen Marken begrüßte daher auch ein lauter, anhaltender Jubelruf den Löwen des Gränzpfahls, aber die gehegte Hoffnung auf einen feierlichen Einzug
in die Hauptstadt des Landes ging nicht in Erfüllung und da der Tag ihrer Ankunft überhaupt nicht in weiterer Verbreitung bekannt geworden war, sollte auch für sie nicht gelten was einer unserer Dichter singt:
Und jedes Heer mit Sing und Sang
Mit Paukenschlag und Kling und Klang
Geschmückt mit grünen Reisern
Zog heim zu seinen Häusern
Und überall, all überall
Auf Stegen und auf Wegen
Zog Alt und Jung dem Jubelschall
Der Kommenden entgegen.
Ein schmerzliches Gefühl veranlaßt auch die
Wahrnehmung, daß die vaterländische Zeitung zwar mit Redseligkeit den feierlichen Empfang der hannoverschen Garde und anderer Truppen mittheilt, aber auch nicht mit einem kargen Worte es verkündet, daß die
vaterländischen Krieger nun auch wieder heimgekehrt wären. “
|
|
1840
|
Fouqué, Friedrich de La Motte. Lebensgeschichte. Halle. Digitalisiert von Google
“[S. 8] Sein erster Hauslehrer - der Knabe mochte noch kaum fünf Jahre zählen - gewann ihm das ganze Herz. Es war ein weicher, inniger, poetisch empfindender junger Candidat der
Theologie, zu Halle seine Universitätsjahre beendet habend, welcher seinen kleinen Zögling in dessen ahnungsreichen Anklängen von Ritterlichkeit und Liedeslust gar wohl verstand. Schon dazumal stammelte der
kindliche Geist an den Gedichten der zwei Gebrüder Stolberg und Bürgers. Das Lesen hatte er sehr früh fertig erlernt, so auch das Schreiben.
[S. 220] Wohl tauchte bisweilen ein Bewußtsein in ihm auf, ähnlich
dem Worte Correggio's: ´Anch'io son pittore.´Aber nur um so entschiedener hielt er sich an den Beschluß, bei seinen Lebzeiten von ihm beschiedenen Mysterien der Muse nichts zu veröffentlichen. Schon hatte er an
fremden Schmerzens-Beispielen gesehn, wie herb oftmal Edles von der Tadelsucht Mitlebender aufgenommen werde. Hatte ja doch selbst Schiller in überspannter Korrektheit erklärt: Bürger sei kein Dichter, und
vielleicht damit das ohnehin blutende Herz Bürgers vollends gebrochen. Furcht war es nicht, was davor in Fouque's Seele brach, wohl aber edle Scheu, seine lieben Blumen von Irgendwem beworfen zu sehn mit Staub, wohl
gar - je nachdem der Werfer nun eben genaturt sei - mit noch Schlimmerm. “
|
|
1840
|
Knobbe, Theodor von. Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben. Bremen. Digitalisiert von Google
“[S. 109] Nie vergesse ich den Eindruck, welchen eine Ballade, (im Sinne des Pfarrers Tochter zu Taubenhain) mit den langsam gezogenen Refrain, in mir erweckte:
´Und als er ein Stück gereiset war,
Sieht er sechs Gräber graben.
Wiederum dum da, wiederum dum da,
[...]´ “
|
|
1840
|
Simrock, Karl. Neckarthal. In: Das malerische und romantische Rheinland. Leipzig. Digitalisiert von Google
“[S. 112] Vermuthlich entsprang die Beschuldigung aus der Ungeduld der Reisenden, welche die hochgerühmte unvergleichliche Gegend in so grosser Menge dahin zieht, und die es leicht, wie
um den Genuss, so um die gute Laune bringt, wenn zufällig ein Regenwetter in ihren kurzen Aufenthalt fällt. Wie es aber die schlimmsten Früchte nicht sind, woran die Wespen nagen, so pflegen auch die Gegenden, wo
die Klage über schlechtes Wetter am häufigsten und lautesten erschallt, gerade die schönsten zu sein, wie man sich aus den Fremdenbüchern leicht überzeugen kann. “
|
|
1840
|
16. Rez. Dramatische Schriften (Die Dramatiker der Jetztzeit von Ludolf Wienbarg). In: Blätter für literarische Unterhaltung, 21. März. Leipzig Digitalisiert von Google
“[S. 322] Daß so viel Gutes in Deutschland verkannt und nicht beachtet wird, liegt daran, daß man so viel Schlechtes und Mittelmäßiges, weil der Modegeschmack dafür ist, aus
Nachgiebigkeit gegen die Mode und um nicht zu widersprechen, lobt, entschuldigt, rechtfertigt, vergöttert und verhimmelt, daß man, wie der deutsche Biedermann Bürger empfand und sich ausdrückte, ´gemeines Maß so
gern für großes preist´. “
|
|
1840
|
Auerbach, Berthold. Der Ultimo. Lustspiel in einem Aufzuge. In: Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1840, Frankfurt am Main. Digitalisiert von Google
“[S. 341] Kammerr. v. Dornh. Wissen Sie auch schon. daß das morgige Regierungsblatt die Ernennung des Major Neumann bei den Dragonern zum Obristen enthalten wird? Dadurch
avancirt der Hauptmann Lemm zum Major, und der Oberlieutenant von Sturm wird Hauptmann und kann die Leonore Weidmann unter die Haube bringen.
Leontine. Das gibt eine Sturmhaube.
Fr. v. Cord. Lenore fuhr um's Morgenroth
Empor aus schweren Träumen:
Bist untreu, Wilhelm, oder todt -
ach, wir leben doch gegen die Vergangenheit in einer furchtbar prosaischen Zeit; [...]. “
|
|
1840
|
Helbig Es gibt nur Ein Heilprinzip. In: Medicinische Jahrbücher, III. Band, Berlin. Digitalisiert von Google
“[S. 108] Beim Studium der A. M. L. stiess ich nun immerwährend auf die Wechselwirkungen und zwar in allen nur möglichen Richtungen; als ich sie aber theils mit meinen Feindschafts- und
Freundschafts-Erfahrungen, so wie mit vielen andern Wechselwirkungen in vielen Fächern des Wissens verglich und sie hin und her bald so bald so betrachtete, da fand ich immer mehr, dass alle Freundschaft
Contrarietät und Wechselwirkung a) blos eine einseitige Ansicht der Sache, b) eine Art Fortbildung ist und c) dass zwischen den Funken, welche vor einem Auge auf- und abfliegen, zwischen den Gefühlen und
Empfindungen im Gemüth etc. bis zu dem grössten Kriege blos ein successiver Uebergang Statt findet.
´Blondine sah her, Lenardo sah hin, (Gegensatz)
Mit Augen erleuchtet vom zärtlichsten Sinn (Einheit)
Blondine, die schönste Prinzessin der Welt,
Lenardo, der Schönste zum Diener bestellt (beides mehrfach).
Das däuchte dem Diener so wohl und bang!
So bang und so wohl! er zweifelte lang;
Viel zweifelt er her, viel zweifelt er hin;
Von Hoffen und Ahnden war trunken sein Sinn´.
Je mehr Gegensätze zwischen zwei Dingen sind, desto fremdartiger sind sie sich. Ein Greis, welcher in einer Winternacht auf der Zinne eines Bergschlosses Wache hält, ist einem neugehorenen Mädchen, das an einem
Sommertage in einer Schiffscajüte schläft, gewiss so fremdartig, als sich zwei Menschen nur immer sein können, löset es aber auf, zergliedert Alles und ihr werdet finden, dass sich 8 his 10 einzelne Gegensätze
zwischen beiden nachweisen lassen: Greis - Kind; Mann - Weib; Berg - Thal; Haus - Schiff; Schloss - Cajüte; Sommer - Winter; Nacht - Tag; Wachen Schlafen etc.
[hat keinen Bezug zu Bürger, besitzt jedoch
gewissen Unterhaltungswert:] 1829 hatte ich die etwa sechsjährige Tochter des Herrn R. R. A. an Darmentzündung zu behandeln. Ich gab, was ich damals wusste, Acon., Bellad., Mercur, Bryon., etc. und liess warme
Umschläge von Hafergrütze machen. Die Krankheit stieg aber trotz aller Mittel. ´Wir wollen doch einen warmen Kuhfladen auflegen, er ist uns so sehr gerühmt worden´, sagten die Frauensleute. Ich liess es um so mehr
geschehen, da ich schon von einem ähnlichen Fall gehört hatte, wo man die Brühe aus einem solchen Fladen mit bestem Erfolge zu trinken gegeben hatte. Kaum war der Kuhfladen aufgelegt, da bekam das Kind auch schon
Ruhe und war nach einer Stunde so gut wie geheilt.”
|
|
1840
|
Anonym. Feuilleton. In: Münchener Unterhaltungsblatt Nr. 66, Beilage zum Bayerischen Volksfreund, München. Digitalisiert von Google
“[Sp. 437] Horace Vernet's wunderbarliches Bildniß der ´Lenore´ von Bürger ist nun in einem trefflichen Kupferstich erschienen, der in einer hiesigen Kunsthandlung ausgestellt, das
Interesse der Künstler erregt. Der gute Franzose hat sein Bild so ´allemand´ als möglich gemacht, er hat aber eben dadurch bewiesen, daß er nicht Deutsch oder nichts Deutsches versteht. Ein gepanzerter Ritter, das
blonde, naive Fräulein, des Wilhelms Kopf ei Todtenschädel mit Schnurrbart und feurigen Augen, das Grab des alten Recken, Nachteule, Todenzug u.s.w. - das ist alles sehr seltsam, aber von Bürgers ´Lenore´ ist
freilich auch gar nichts daran als die Unterschrift.”
|
|
1840
|
Rellstab, Ludwig. Arie. In: Vielka. Oper in 3 Akten. Musik von G(iacomo) Meyerbeer, Wien. Digitalisiert von Google
“[S. 6] Da tönt's von Ferne: hopp, hopp, hopp!
Und Reiter sah ich im Galopp
Durch's Blachfeld sausend streichen -
Mit Schrecken füllt mich die Gefahr;
Doch wußte ich der Feinde Schaar
Vorsichtig auszuweichen.
Dicht an der Brücke fand ich mich,
Du biegst Dich d'runter, dachte ich,
Die Reiter trabben oben;
Doch d'runten saß ein Offizier,
Zu schweigen winkt' er strenge mir,
Den Krückstock hoch gehoben.
Und über uns ging's hopp, hopp, hopp!
Der Reiter sausender Galopp.
Ich saß mit Angst und Beben,
Doch er sprach ruhig: Sind sie fort,
Sollst Du nach einem sichern Ort
Mit mir Dich hinbegeben.”
|
|
1840
|
Anonym. Bilder aus dem Leben von -e. In: Sundine, 01.04.
“[S. 108] Das De- und Emberquement seiner Person und Sachen war bald gethan, er sank von seinem fetten Throne sanft in die Pinasse seines neuen Schiffsherrn hinab, dessen genauere Betrachtung ihm jedoch eben so wenig, als seine Umgebung zusagte. Denn
´Wie Vollmond glänzte sein feistes Gesicht´,
die verrätherische Farbe der eingefleischten Säufer auf Nase und Wange tragend.”
|
|
1840
|
Sch.a.J. Anmerkung zu Der Antistes Hurter von Schaffhausen und seine Amtsbrüder. In: Augsburger Postzeitung, 16.08.
“*) Zwar schreien und schreiben die Radikalen immer ´Frei der freie Mann zum freien Volk´: aber wenn einer den Muth hat von einer Volks- oder Zeitungskanzel herab dem sogenannten freien Volk die
Wahrheit zu sagen [...]. Doch Dank sey den Radikalen für diese ihre Handlungsweise, sie haben damit schon manchem die Augen geöffnet: denn nur die guten Früchte sind es, an denen die Wespen und die Radikalen nagen.”
|
|
1840
|
Anzeige. In: Karlsruher Zeitung 15.11.
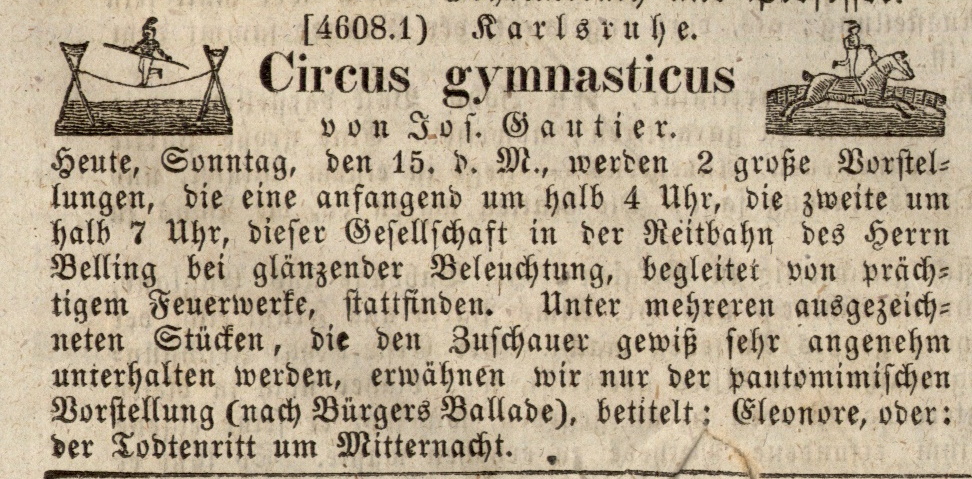
|
|
1840
|
Vermischtes. In: Karlsruher Zeitung 14.11
In einer der nächsten Vorstellungen soll, wie wir hören, Eleonore oder der Todtenritt um Mitternacht, nach Bürgers bekannter Ballade, bei schauerlich schöner Beleuchtung ausgeführt
werden, ein Stück, das, Zeitungsnachrichten zufolge, in andern Städten großes Aufsehen erregte. Wir sind sehr gespannt darauf. Ob wohl das lebende Skelett darin auftritt?"
|
|
bis 1789 1790-1799 1800-1806 1807-1815 1816-1821 1822-1825 1826-1828 1829-1831
1832-1836 1837-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1858 1859-1861 1862-1865
1866-1868 1869-1870 1871-1880 1881-1897 1898-1915 1916-1949 ab 1950
nach oben
29032023-164
|
|